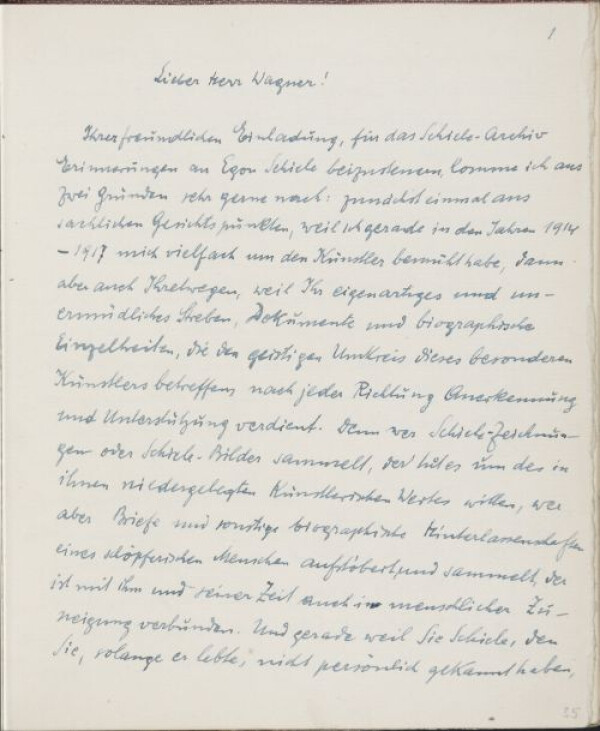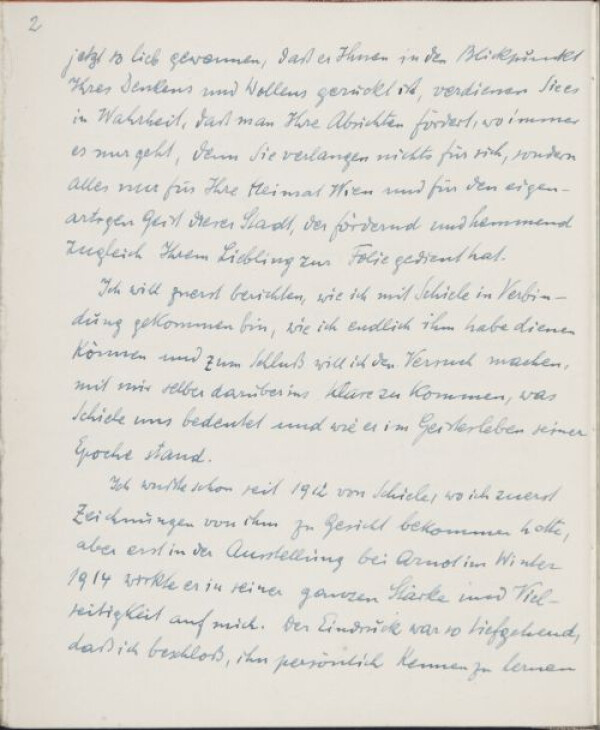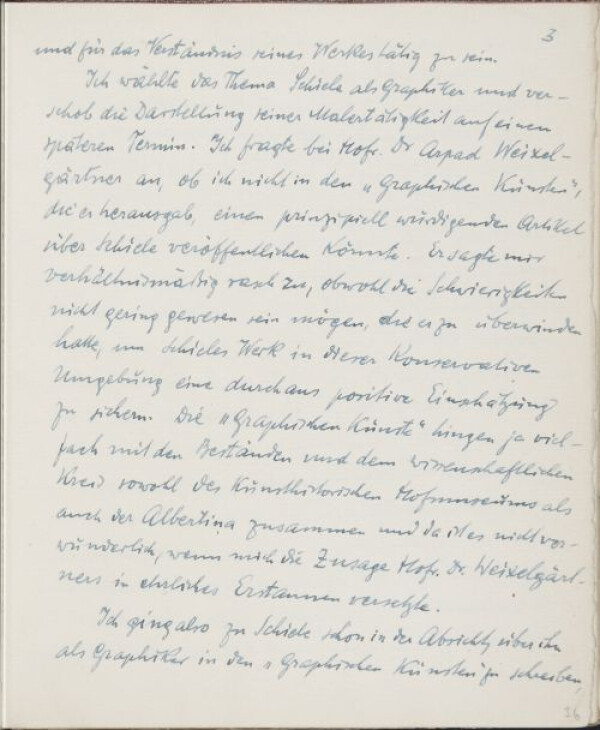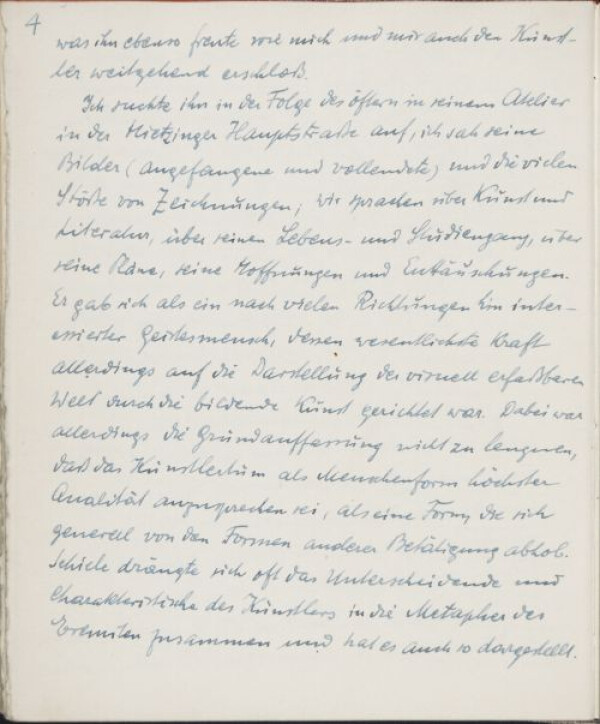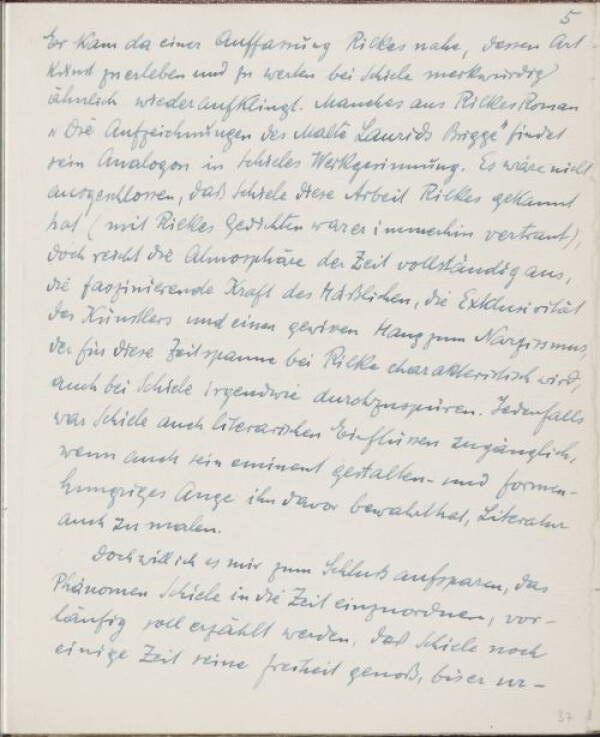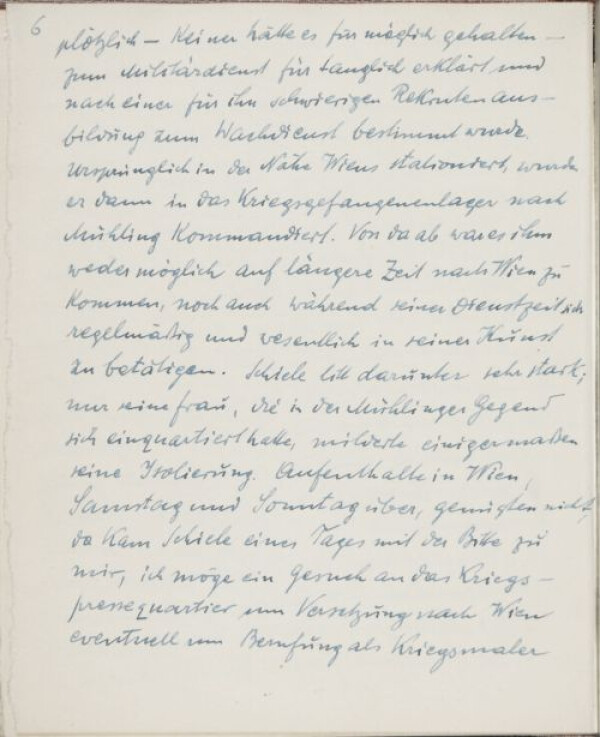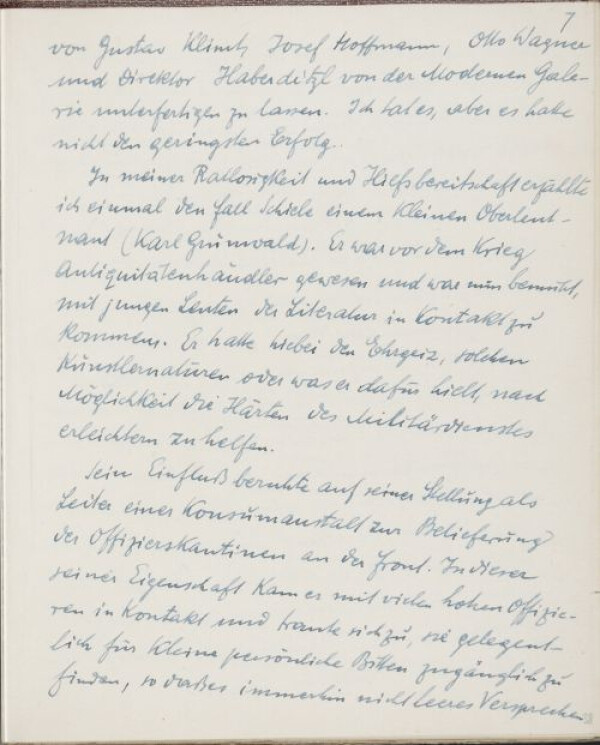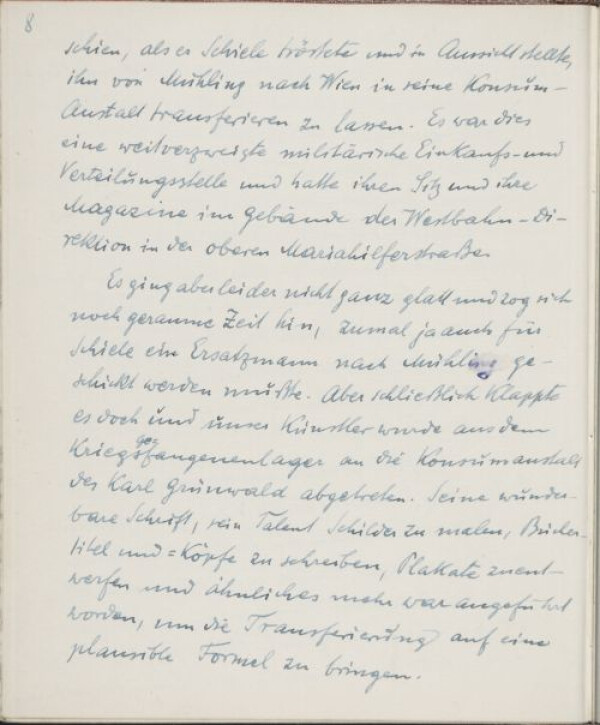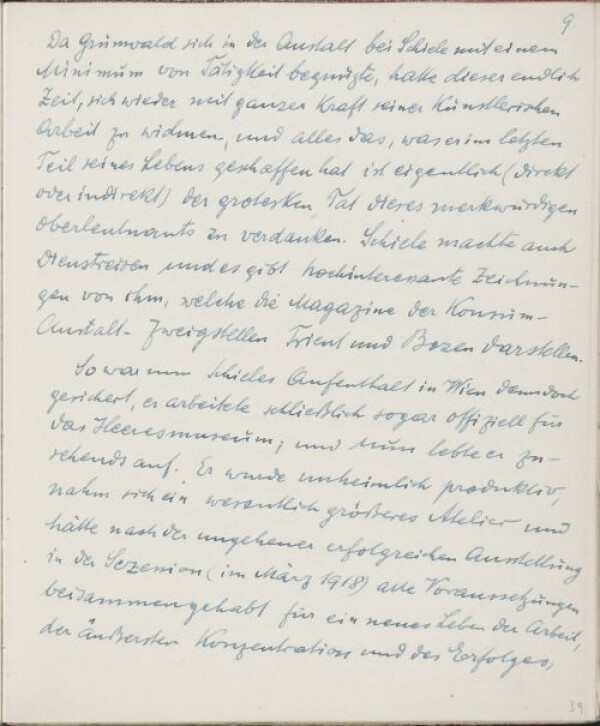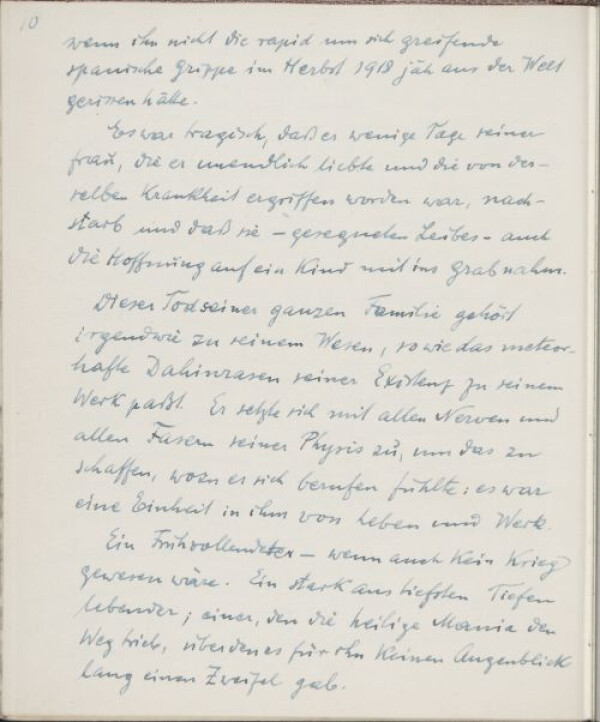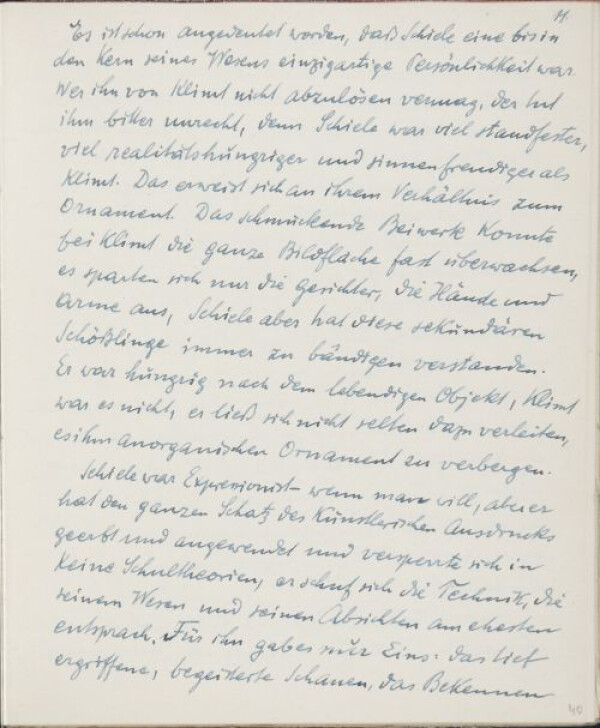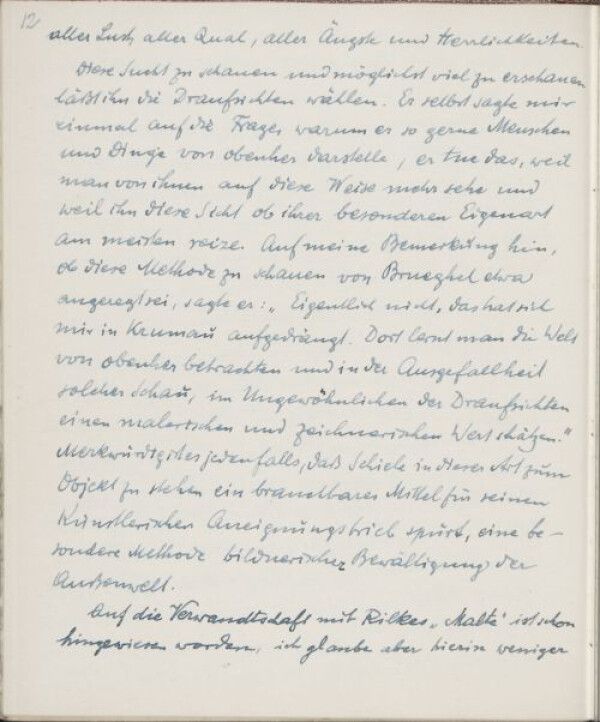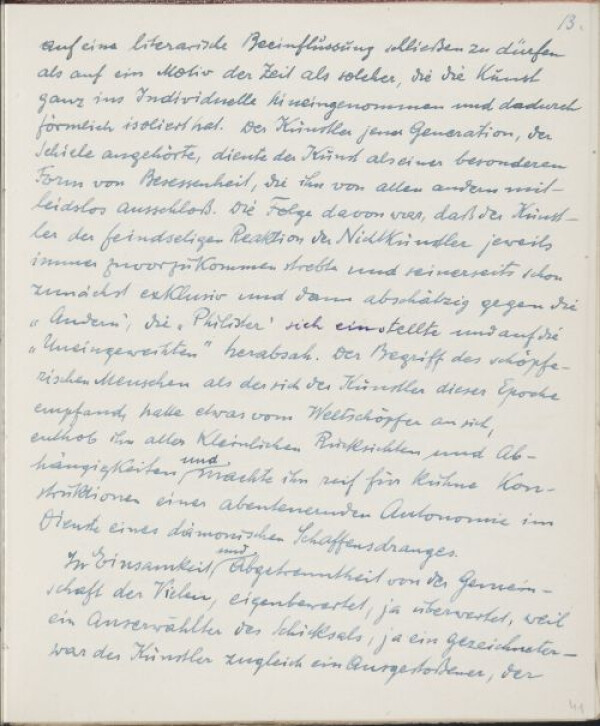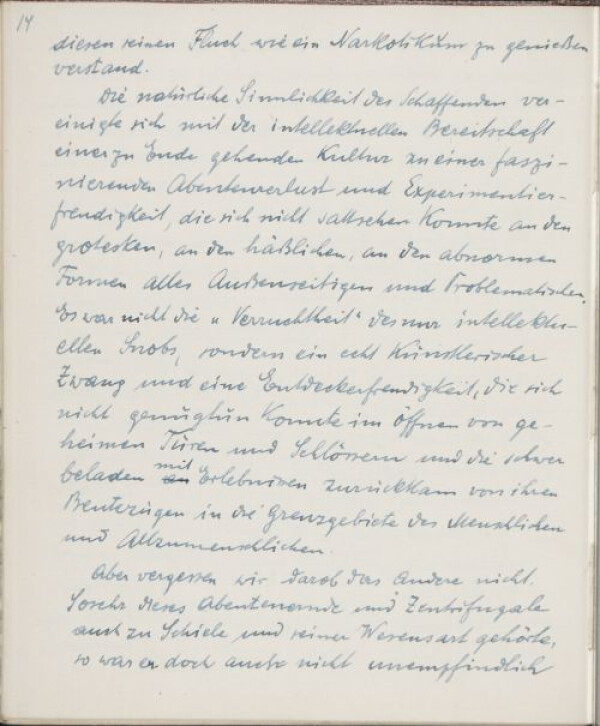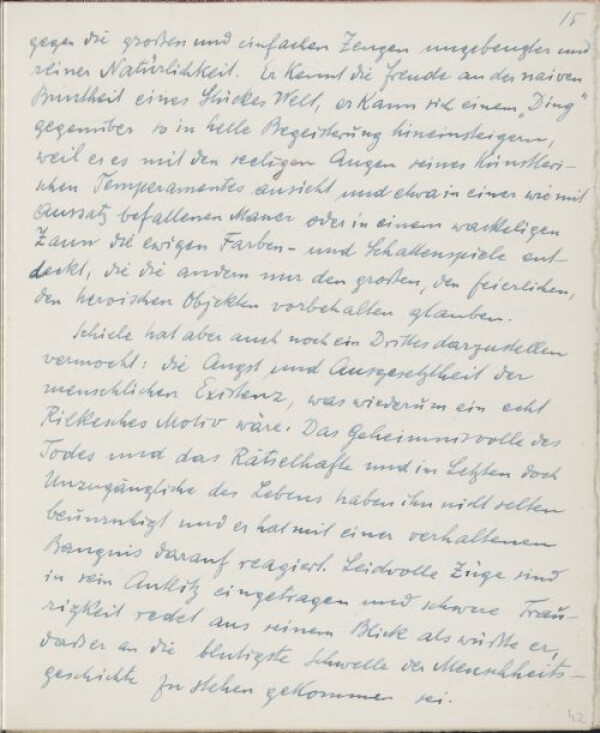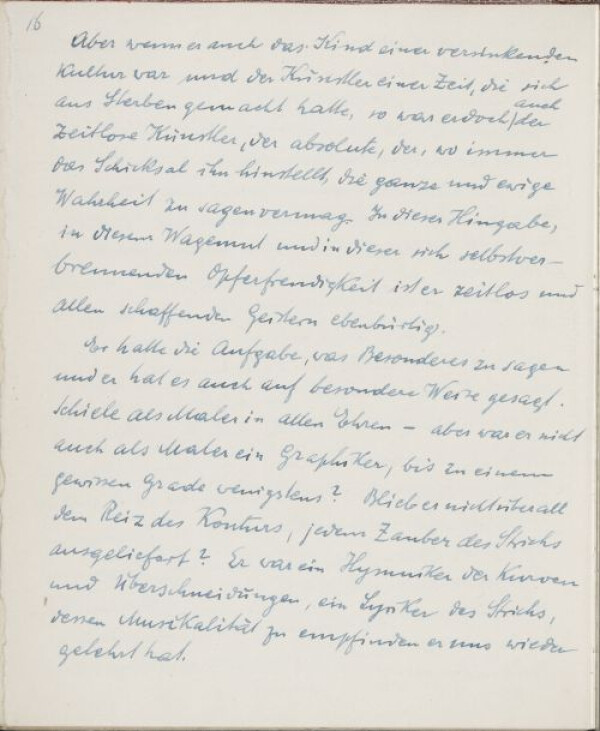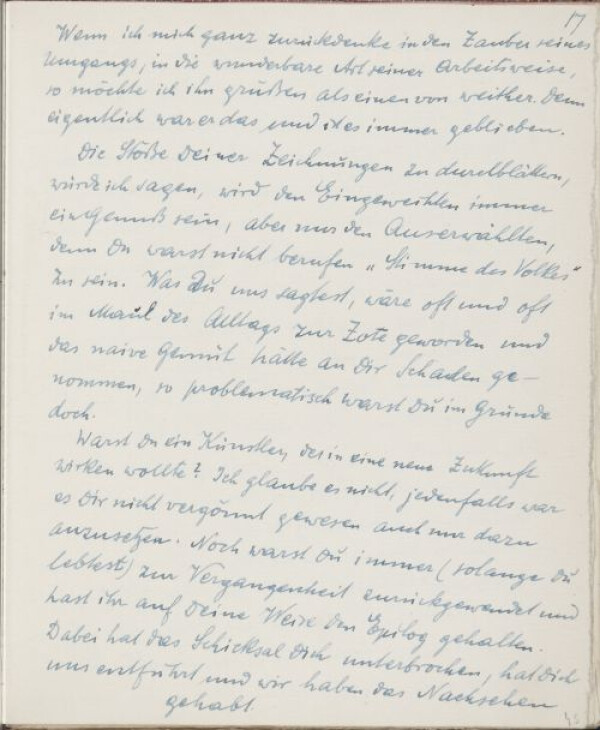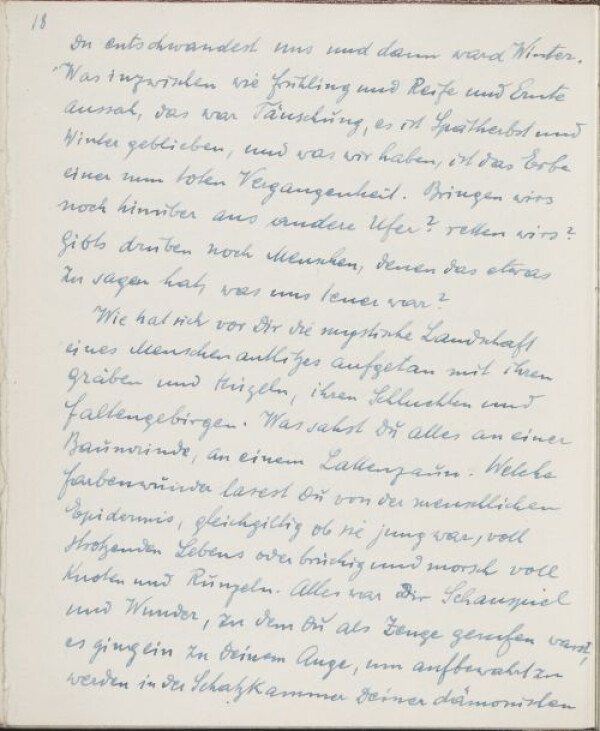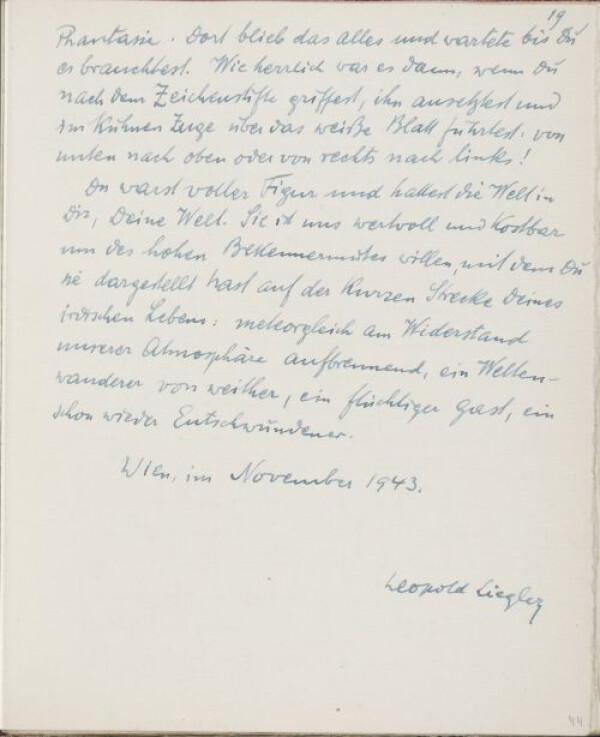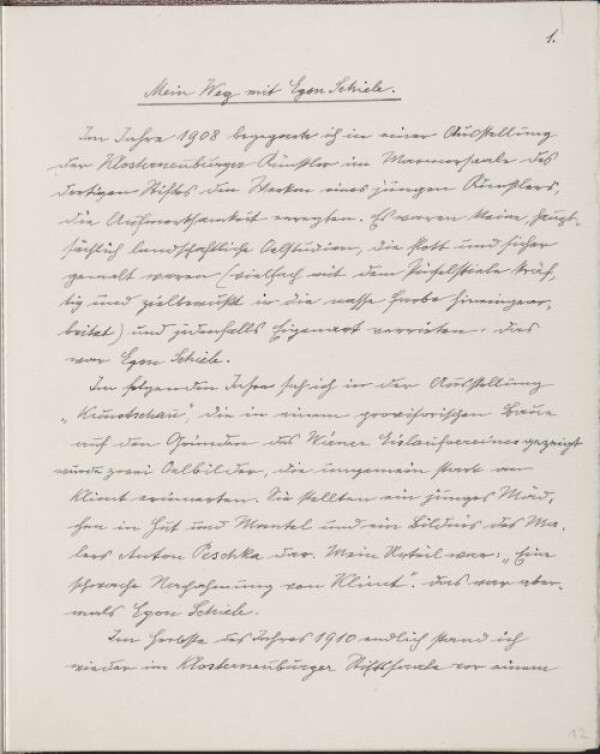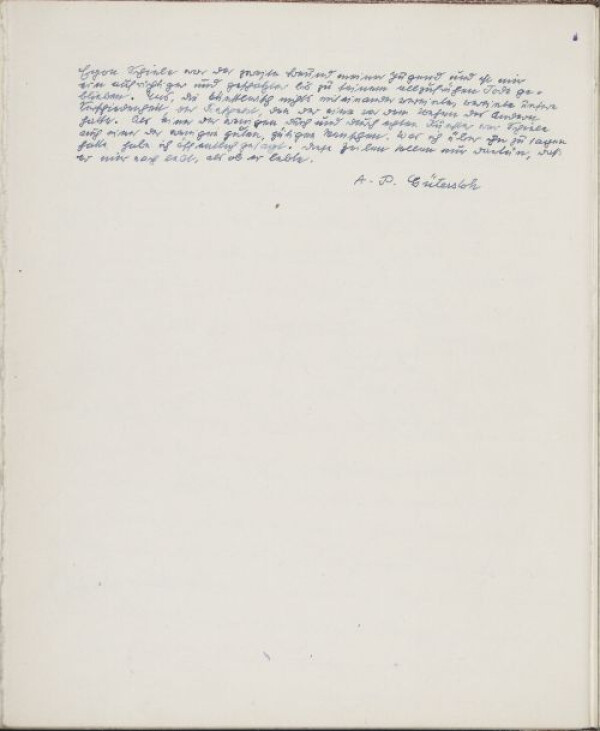Beitrag von Leopold Liegler für das „Erinnerungsbuch Egon Schiele“
Albertina, Wien
ESDA ID
2565
Nebehay 1979
Nicht gelistet/Not listed
Bestandsnachweis
Albertina, Wien, Inv. ESA 508/35–44
Ort
Wien
Datierung
11.1943 (eigenhändig)
Material/Technik
Schwarze Tinte auf Papier
Maße
19 x 15,5 cm (Seite)
Transkription
Lieber Herr Wagner!
Ihrer freundlichen Einladung, für das Schiele-Archiv
Erinnerungen an Egon Schiele beizusteuern, komme ich aus
zwei Gründen sehr gerne nach: zunächst einmal aus
sachlichen Gesichtspunkten, weil ich gerade in den Jahren 1914
– 1917 mich vielfach um den Künstler bemüht habe, dann
aber auch Ihretwegen, weil Ihr eigenartiges und un-
ermüdliches Streben, Dokumente und biographische
Einzelheiten, die den geistigen Umkreis dieses besonderen
Künstlers betreffen, nach jeder Richtung Anerkennung
und Unterstützung verdient. Denn wer Schiele-Zeichnun-
gen oder Schiele-Bilder sammelt, der tut es um des in
ihnen niedergelegten künstlerischen Wertes willen, wer
aber Briefe und sonstige biographische Hinterlassenschaften
eines schöpferischen Menschen aufstöbert, und sammelt, der
ist mit ihm und seiner Zeit auch in menschlicher Zu-
neigung verbunden. Und gerade weil Sie Schiele, den
Sie, solange er lebte, nicht persönlich gekannt haben,
||
jetzt so lieb gewonnen, daß er Ihnen in den Blickpunkt
Ihres Denkens und Wollens gerückt ist, verdienen Sie es
in Wahrheit, daß man Ihre Absichten fördert, wo immer
es nur geht, denn Sie verlangen nichts für sich, sondern
alles nur für Ihre Heimat Wien und für den eigen-
artigen Geist dieser Stadt, der fördernd und hemmend
zugleich Ihrem Liebling zur Folie gedient hat.
Ich will zuerst berichten, wie ich mit Schiele in Verbin-
dung gekommen bin, wie ich endlich ihm habe dienen
können und zum Schluß will ich den Versuch machen,
mit mir selber darüber ins Klare zu kommen, was
Schiele uns bedeutet und wie er im Geistesleben seiner
Epoche stand.
Ich wußte schon seit 1912 von Schiele, wo ich zuerst
Zeichnungen von ihm zu Gesicht bekommen hatte,
aber erst in der Ausstellung bei Arnot im Winter
1914 wirkte er in seiner ganzen Stärke und Viel-
seitigkeit auf mich. Der Eindruck war so tiefgehend,
daß ich beschloß, ihn persönlich kennen zu lernen
||
und für das Verständnis reines Werkes tätig zu sein.
Ich wählte das Thema Schiele als Graphiker und ver-
schob die Darstellung seiner Malertätigkeit auf einen
späteren Termin. Ich fragte bei Hofr.[at] Dr Arpad Weixel-
gärtner [!] an, ob ich nicht in den „Graphischen Künsten“,
die er herausgab, einen prinzipiell würdigenden Artikel
über Schiele veröffentlichen könnte. Er sagte mir
verhältnismäßig rasch zu, obwohl die Schwierigkeiten
nicht gering gewesen sein mögen, die er zu überwinden
hatte, um Schieles Werk in dieser konservativen
Umgebung eine durchaus positive Einschätzung
zu sichern. Die „Graphischen Künste“ hingen ja viel-
fach mit den Beständen und dem wissenschaftlichen
Kreis sowohl des Kunsthistorischen Hofmuseums als
auch der Albertina zusammen und da ist es nicht ver-
wunderlich, wenn mich die Zusage Hofr. Dr. Weixelgärt-
ners [!] in ehrliches Erstaunen versetzte.
Ich ging also zu Schiele schon in der Absicht, über ihn
als Graphiker in den „Graphischen Künsten“ zu schreiben,
||
was ihn ebenso freute wie mich und mir auch den Künst-
ler weitgehend erschloss.
Ich suchte ihn in der Folge des öfteren in seinem Atelier
in der Hietzinger Hauptstraße auf, ich sah seine
Bilder (angefangene und vollendete) und die vielen
Stöße von Zeichnungen; wir sprachen über Kunst und
Literatur, über seinen Lebens- und Studiengang, über
seine Pläne, seine Hoffnungen und Enttäuschungen.
Er gab sich als ein nach vielen Richtungen hin inter-
essierter Geistesmensch, dessen wesentliche Kraft
allerdings auf die Darstellung der visuell erfaßbaren
Welt durch die bildende Kunst gerichtet war. Dabei war
allerdings die Grundauffassung nicht zu leugnen,
daß das Künstlertum als Menschenform höchster
Qualität anzusprechen sei, als eine Form, die sich
generell von Formen anderer Betätigung abhob.
Schiele drängte sich oft das Unterscheidende und
Charakteristische des Künstlers in die Metapher des
Eremiten zusammen und hat es auch so dargestellt.
||
Er kam da einer Auffassung Rilkes nahe, dessen Art
Kunst zu erleben und zu werten bei Schiele merkwürdig
ähnlich wieder aufklingt. Manches aus Rilkes Roman
„Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ findet
sein Analogon in Schieles Werkgesinnung. Es wäre nicht
ausgeschlossen, daß Schiele diese Arbeit Rilkes gekannt
hat (mit Rilkes Gedichten war er immerhin vertraut),
doch reicht die Atmosphäre der Zeit vollständig aus,
die faszinierende Kraft des Häßlichen, die Exklusivität
des Künstlers und einen gewissen Hang zum Narzissmus,
der für diese Zeitspanne bei Rilke charakteristisch wird,
auch bei Schiele irgendwie durchzuspüren. Jedenfalls
war Schiele auch literarischen Einflüssen zugänglich,
wenn auch sein eminent gestalten- und formen-
hungriges Auge ihn davor bewahrt hat, Literatur
auch zu malen.
Doch will ich es mir zum Schluß aufsparen, das
Phänomen Schiele in die Zeit einzuordnen, vor-
läufig soll erzählt werden, daß Schiele noch
einige Zeit seine Freiheit genoß, bis er ur-
||
plötzlich – keiner hätte es für möglich gehalten –
zum Militärdienst für tauglich erklärt und
nach einer für ihn schwierigen Rekrutenaus-
bildung zum Wachdienst bestimmt wurde.
Ursprünglich in der Nähe Wiens stationiert, wurde
er dann in das Kriegsgefangenenlager nach
Mühling kommandiert. Von da ab war es ihm
weder möglich auf längere Zeit nach Wien zu
kommen, noch auch während seiner Dienstzeit sich
regelmäßig und wesentlich in seiner Kunst
zu betätigen. Schiele litt darunter sehr stark;
nur seine Frau, die in der Mühlinger Gegend
sich einquartiert hatte, milderte einigermaßen
seine Isolierung. Aufenthalte in Wien,
Samstag und Sonntag über, genügten nicht,
da kam Schiele eines Tages mit der Bitte zu
mir, ich möge ein Gesuch an das Kriegs-
pressequartier um Versetzung nach Wien
eventuell um Berufung als Kriegsmaler
||
von Gustav Klimt, Josef Hoffmann, Otto Wagner
und Direktor Haberditzl von der Modernen Gale-
rie unterfertigen zu lassen. Ich tat es, aber es hatte
nicht den geringsten Erfolg.
In meiner Ratlosigkeit und Hilfsbereitschaft erzählte
ich einmal den Fall Schiele einem kleinen Oberleut-
nant (Karl Grünwald). Er war vor dem Krieg
Antiquitätenhändler gewesen und war nun bemüht,
mit jungen Leuten der Literatur in Kontakt zu
kommen. Er hatte hiebei den Ehrgeiz, solchen
Künstlernaturen oder was er dafür hielt, nach
Möglichkeit die Härten des Militärdienstes
erleichtern zu helfen.
Sein Einfluß beruhte auf seiner Stellung als
Leiter einer Konsumanstalt zur Belieferung
der Offizierskantinen an der Front. In dieser
seiner Eigenschaft kam er mit vielen hohen Offizie-
ren in Kontakt und traute sich zu, sie gelegent-
lich für kleine persönliche Bitten zugänglich zu
finden, so daß es immerhin nicht leeres Versprechen
||
schien, als er Schiele tröstete und in Aussicht stellte,
ihn von Mühling nach Wien in seine Konsum-
Anstalt transportieren zu lassen. Es war dies
eine weitverzweigte militärische Einkaufs- und
Verteilungsstelle und hatte ihren Sitz und ihre
Magazine im Gebäude der Westbahn-Di-
rektion in der oberen Mariahilferstraße.
Es ging aber leider nicht ganz glatt und zog sich
noch geraume Zeit hin, zumal ja auch für
Schiele ein Ersatzmann nach Mühling ge-
schickt werden mußte. Aber schließlich klappte
es doch und unser Künstler wurde aus dem
Kriegsgefangenenlager an die Konsumanstalt
des Karl Grünwald abgetreten. Seine wunder-
bare Schrift, sein Talent Schilder zu malen, Bücher-
titel und -köpfe zu schreiben, Plakate zu ent-
werfen und ähnliches mehr war angeführt
worden, um die Transferierung auf eine
plausible Formel zu bringen.
||
Da Grünwald sich in der Anstalt bei Schiele mit einem
Minimum von Tätigkeit begnügte, hatte dieser endlich
Zeit, sich wieder mit ganzer Kraft seiner künstlerischen
Arbeit zu widmen, und alles das, was er im letzten
Teil seines Lebens geschaffen hat ist eigentlich (direkt
oder indirekt) der grotesken Tat dieses merkwürdigen
Oberleutnants zu verdanken. Schiele machte auch
Dienstreisen und es gibt hochinteressante Zeichnun-
gen von ihm, welche die Magazine der Konsum-
Anstalt-Zweigstellen Triest und Bozen darstellen.
So war nun Schieles Aufenthalt in Wien dennoch
gesichert, er arbeitete schließlich sogar offiziell für
das Heeresmuseum; und nun lebte er zu-
sehends auf. Er wurde unheimlich produktiv,
nahm sich ein wesentlich größeres Atelier und
hätte nach der ungeheuer erfolgreichen Ausstellung
in der Sezession (im März 1918) alle Voraussetzungen
beisammengehabt für ein neues Leben der Arbeit,
der äußersten Konzentration und des Erfolges,
||
wenn ihn nicht die rapid um sich greifende
spanische Grippe im Herbst 1918 jäh aus der Welt
gerissen hätte.
Es war tragisch, daß er wenige Tage seiner
Frau, die er unendlich liebte und die von der-
selben Krankheit ergriffen worden war, nach-
starb und daß sie – gesegneten Leibes – auch
die Hoffnung auf ein Kind mit ins Grab nahm.
Dieser Tod seiner ganzen Familie gehört
irgendwie zu seinem Wesen, so wie das meteor-
hafte Dahinrasen seiner Existenz zu seinem
Werk paßt. Er setzte sich mit allen Nerven und
allen Fasern seiner Physis zu, um das zu
schaffen, wozu er sich berufen fühlte; es war
eine Einheit in ihm von Leben und Werk.
Ein Frühvollendeter – wenn auch kein Krieg
gewesen wäre. Ein stark aus tiefsten Tiefen
lebender; einer, den die heilige Mania den
Weg trieb, über den es für ihn keinen Augenblick
lang einen Zweifel gab.
||
Es ist schon angedeutet worden, daß Schiele eine bis in
den Kern seines Wesens einzigartige Persönlichkeit war.
Wer ihn von Klimt nicht abzulösen vermag, der tut
ihm bitter unrecht, denn Schiele war viel standfester,
viel realitätshungriger und sinnenfreudiger als
Klimt. Das erweist sich an ihrem Verhältnis zum
Ornament. Das schmückende Beiwerk konnte
bei Klimt die ganze Bildfläche fast überwachsen,
es sparten sich nur die Gesichter, die Hände und
Arme aus, Schiele aber hat diese sekundären
Schößlinge immer zu bändigen verstanden.
Er war hungrig nach dem lebendigen Objekt, Klimt
war es nicht, er ließ sich nicht selten dazu verleiten,
es ihm [im] anorganischen Ornament zu verbergen.
Schiele war Expressionist – wenn man will, aber er
hat den ganzen Schatz des künstlerischen Ausdrucks
geerbt und angewendet und versperrte sich in
keine Schultheorien, er schuf sich die Technik, die
seinem Wesen und seinen Absichten am ehesten
entsprach. Für ihn gab es nur Eins: das tief
ergriffene, begeisterte Schauen, das Bekennen
||
aller Lust, aller Qual, aller Ängste und Herrlichkeiten.
Diese Sucht zu schauen und möglichst viel zu erschauen
läßt ihn die Draufsichten wählen. Er selbst sagte mir
einmal auf die Frage, warum er so gerne Menschen
und Dinge von obenher darstelle, er tue das, weil
man von ihnen auf diese Weise mehr sehe und
weil ihn diese Sicht ob ihrer besonderen Eigenart
am meisten reize. Auf meine Bemerkung hin,
ob diese Methode zu schauen von Brueghel etwa
angeregt sei, sagte er: „Eigentlich nicht, das hat sich
mir in Krumau aufgedrängt. Dort lernt man die Welt
von obenher betrachten und in der Ausgefallheit [!]
solcher Schau, im Ungewöhnlichen der Draufsichten
einen malerischen und zeichnerischen Wert schätzen.“
Merkwürdig ist es jedenfalls, daß Schiele in dieser Art zum
Objekt zu stehen ein brauchbares Mittel für seinen
künstlerischen Aneignungstrieb spürt, eine be-
sondere Methode bildnerischer Bewältigung der
Außenwelt.
Auf die Verwandtschaft mir Rilkes „Malte“ ist schon
hingewiesen worden, ich glaube aber hierin weniger
||
auf eine literarische Beeinflussung schließen zu dürfen
als auf ein Motiv der Zeit als solcher, die die Kunst
ganz ins Individuelle hineingenommen und dadurch
förmlich isoliert hat. Der Künstler jener Generation, der
Schiele angehörte, diente der Kunst als einer besonderen
Form von Besessenheit, die ihn von allen andern mit-
leidslos ausschloß. Die Folge davon war, daß der Künst-
ler der feindseligen Reaktion der Nichtkünstler jeweils
immer zuvorzukommen strebte und seinerseits schon
zunächst exklusiv und dann abschätzig gegen die
„Andern“, die „Philister“ sich einstellte und auf die
„Uneingeweihten“ herabsah. Der Begriff des schöpfe-
rischen Menschen als der sich der Künstler dieser Epoche
empfand, hatte etwas vom Weltschöpfer an sich,
enthob ihn aller kleinlichen Rücksichten und Ab-
hängigkeiten und machte ihn reif für kühne Kon-
struktionen einer abenteuernden Anatomie im
Dienste eines dämonischen Schaffensdranges.
In Einsamkeit und Abgetrenntheit von der Gemein-
schaft der Vielen, eigenbewertet, ja überwertet, weil
ein Auserwählter des Schicksals, ja ein gezeichneter –
war der Künstler zugleich ein Ausgestoßener, der
||
diesen reinen Fluch wie ein Narkotikum zu genießen
verstand.
Die natürliche Sinnlichkeit des Schaffenden ver-
einigte sich mit der intellektuellen Bereitschaft
einer zu Ende gehenden Kultur zu einer faszi-
nierenden Abenteuerlust und Experimentier-
freudigkeit, die sich nicht sattsehen konnte an den
grotesken, an den häßlichen, an den abnormen
Formen alles Außenseitigen und Problematischen.
Es war nicht die „Verruchtheit“ des nur intellektu-
ellen Snobs, sondern ein echt künstlerischer
Zwang und eine Entdeckerfreudigkeit, die sich
nicht genugtun konnte im Öffnen von ge-
heimen Türen und Schlössern und die schwer
beladen mit Erlebnissen zurückkam von ihren
Beutezügen in die Grenzgebiete des Menschlichen
und Allzumenschlichen.
Aber vergessen wir darob das Andere nicht.
Sosehr dieses Abenteuernde und Zentrifugale
auch zu Schiele und seiner Wesensart gehörte,
so war er doch auch nicht unempfindlich
||
gegen die großen und einfachen Zeugen ungebeugter und
reiner Natürlichkeit. Er kennt die Freude an der naiven
Buntheit eines Stückes Welt, er kann sich einem „Ding“
gegenüber so in helle Begeisterung hineinsteigern,
weil er es mit den seeligen Augen seines künstleri-
schen Temperamentes ansieht und etwa in einer wie mit
Aussatz befallenen Mauer oder in einem wackeligen
Zaun die ewigen Farben- und Schattenspiele ent-
deckt, die die andern nur den großen, den feierlichen,
den heroischen Objekten vorbehalten glauben.
Schiele hat aber auch noch ein Drittes darzustellen
vermocht: die Angst und Ausgesetztheit der
menschlichen Existenz, was wiederum ein echt
Rilkesches Motiv wäre. Das Geheimnisvolle des
Todes und das Rätselhafte und im Letzten doch
Unzugängliche des Lebens haben ihn nicht selten
beunruhigt und er hat mit einer verhaltenen
Bangnis darauf reagiert. Leidvolle Züge sind
in sein Antlitz eingetragen und schwere Trau-
rigkeit redet aus seinem Blick als wüßte er,
daß er an die blutigste Schwelle der Menschheits-
geschichte zu stehen gekommen sei.
||
Aber wenn er auch das Kind einer versinkenden
Kultur war und der Künstler einer Zeit, die sich
aus Sterben gemacht hatte, so war er doch auch der
zeitlose Künstler, der absolute, der, wo immer
das Schicksal ihn hinstellt, die ganze und ewige
Wahrheit zu sagen vermag. In dieser Hingabe,
in diesem Wagemut und in dieser sich selbstver-
brennenden Opferfreudigkeit ist er zeitlos und
allen schaffenden Geistern ebenbürtig.
Er hatte die Aufgabe, was Besonderes zu sagen
und er hat es auch auf besondere Weise gesagt.
Schiele als Maler in allen Ehren – aber war er nicht
auch als Maler ein Graphiker, bis zu einem
gewissen Grade wenigstens? Blieb er nicht überall
dem Reiz des Konturs, jedem Zauber des Strichs
ausgeliefert? Er war ein Hymniker der Kurven
und Überschneidungen, ein Lyriker des Strichs,
dessen Musikalität zu empfinden er uns wieder
gelehrt hat.
||
Wenn ich mich ganz zurückdenke an den Zauber seines
Umgangs, in die wunderbare Art seiner Arbeitsweise,
so möchte ich ihn grüßen als einen von weither. Denn
eigentlich war er das und ist es immer geblieben.
Die Stöße Deiner Zeichnungen zu durchblättern,
würde ich sagen, wird den Eingeweihten immer
ein Genuß sein, aber nur den Auserwählten,
denn Du warst nicht berufen „Stimme des Volkes“
zu sein. Was Du uns sagtest, wäre oft und oft
im Maul des Alltags zur Zote geworden und
das naive Gemüt hätte an Dir Schaden ge-
nommen, so problematisch warst du im Grunde
doch.
Warst Du ein Künstler, der in eine neue Zukunft
wirken wollte? Ich glaube es nicht, jedenfalls war
es Dir nicht vergönnt gewesen auch nur dazu
anzusetzen. Noch warst du immer (solange Du
lebtest) zur Vergangenheit zurückgewendet und
hast ihr auf Deine Weise den Epilog gehalten.
Dabei hat das Schicksal dich unterbrochen, hat Dich
uns entführt und wir haben das Nachsehen
gehabt.
||
Du entschwandest uns und dann ward Winter.
Was inzwischen wie Frühling und Reife und Ernte
aussah, das war Täuschung, es ist Spätherbst und
Winter geblieben, und was wir haben, ist das Erbe
einer nun toten Vergangenheit. Bringen wirs
noch hinüber ans andere Ufer? retten wirs?
Gibts drüben noch Menschen, denen das etwas
zu sagen hat, was uns teuer war?
Wie hat sich vor Dir die mystische Landschaft
eines Menschenantlitzes aufgetan mit ihren
Gräbern und Hügeln, ihren Schluchten und
Faltengebirgen. Was sahst Du alles in einer
Baumrinde, an einem Lattenzaun. Welche
Farbenwunder lasest Du von der menschlichen
Epidermis, gleichgiltig [!] ob sie jung war, voll
strotzenden Lebens oder brüchig und morsch voll
Knoten und Runzeln. Alles war Dir Schauspiel
und Wunder, zu dem Du als Zeuge gerufen warst,
es ging ein zu Deinem Auge, um aufbewahrt zu
werden in der Schatzkammer Deiner dämonischen
||
Phantasie. Dort blieb Alles und wartete bis Du
es brauchtest. Wie herrlich war es dann, wenn Du
nach dem Zeichenstifte griffest, ihn ansetztest und
im kühnen Zuge über das weiße Blatt führtest: von
unten nach oben oder rechts nach links!
Du warst voller Figur und hattest die Welt in
Dir, Deine Welt. Sie ist uns wertvoll und kostbar
um des hohen Bekennermutes willen, mit dem Du
sie dargestellt hast auf der kurzen Strecke Deines
irdischen Lebens: meteorgleich am Widerstand
unserer Atmosphäre aufbrennend, ein Welten-
wanderer von weither, ein flüchtiger Gast, ein
schon wieder Entschwundener.
Wien, im November 1943.
Leopold Liegler
Ihrer freundlichen Einladung, für das Schiele-Archiv
Erinnerungen an Egon Schiele beizusteuern, komme ich aus
zwei Gründen sehr gerne nach: zunächst einmal aus
sachlichen Gesichtspunkten, weil ich gerade in den Jahren 1914
– 1917 mich vielfach um den Künstler bemüht habe, dann
aber auch Ihretwegen, weil Ihr eigenartiges und un-
ermüdliches Streben, Dokumente und biographische
Einzelheiten, die den geistigen Umkreis dieses besonderen
Künstlers betreffen, nach jeder Richtung Anerkennung
und Unterstützung verdient. Denn wer Schiele-Zeichnun-
gen oder Schiele-Bilder sammelt, der tut es um des in
ihnen niedergelegten künstlerischen Wertes willen, wer
aber Briefe und sonstige biographische Hinterlassenschaften
eines schöpferischen Menschen aufstöbert, und sammelt, der
ist mit ihm und seiner Zeit auch in menschlicher Zu-
neigung verbunden. Und gerade weil Sie Schiele, den
Sie, solange er lebte, nicht persönlich gekannt haben,
||
jetzt so lieb gewonnen, daß er Ihnen in den Blickpunkt
Ihres Denkens und Wollens gerückt ist, verdienen Sie es
in Wahrheit, daß man Ihre Absichten fördert, wo immer
es nur geht, denn Sie verlangen nichts für sich, sondern
alles nur für Ihre Heimat Wien und für den eigen-
artigen Geist dieser Stadt, der fördernd und hemmend
zugleich Ihrem Liebling zur Folie gedient hat.
Ich will zuerst berichten, wie ich mit Schiele in Verbin-
dung gekommen bin, wie ich endlich ihm habe dienen
können und zum Schluß will ich den Versuch machen,
mit mir selber darüber ins Klare zu kommen, was
Schiele uns bedeutet und wie er im Geistesleben seiner
Epoche stand.
Ich wußte schon seit 1912 von Schiele, wo ich zuerst
Zeichnungen von ihm zu Gesicht bekommen hatte,
aber erst in der Ausstellung bei Arnot im Winter
1914 wirkte er in seiner ganzen Stärke und Viel-
seitigkeit auf mich. Der Eindruck war so tiefgehend,
daß ich beschloß, ihn persönlich kennen zu lernen
||
und für das Verständnis reines Werkes tätig zu sein.
Ich wählte das Thema Schiele als Graphiker und ver-
schob die Darstellung seiner Malertätigkeit auf einen
späteren Termin. Ich fragte bei Hofr.[at] Dr Arpad Weixel-
gärtner [!] an, ob ich nicht in den „Graphischen Künsten“,
die er herausgab, einen prinzipiell würdigenden Artikel
über Schiele veröffentlichen könnte. Er sagte mir
verhältnismäßig rasch zu, obwohl die Schwierigkeiten
nicht gering gewesen sein mögen, die er zu überwinden
hatte, um Schieles Werk in dieser konservativen
Umgebung eine durchaus positive Einschätzung
zu sichern. Die „Graphischen Künste“ hingen ja viel-
fach mit den Beständen und dem wissenschaftlichen
Kreis sowohl des Kunsthistorischen Hofmuseums als
auch der Albertina zusammen und da ist es nicht ver-
wunderlich, wenn mich die Zusage Hofr. Dr. Weixelgärt-
ners [!] in ehrliches Erstaunen versetzte.
Ich ging also zu Schiele schon in der Absicht, über ihn
als Graphiker in den „Graphischen Künsten“ zu schreiben,
||
was ihn ebenso freute wie mich und mir auch den Künst-
ler weitgehend erschloss.
Ich suchte ihn in der Folge des öfteren in seinem Atelier
in der Hietzinger Hauptstraße auf, ich sah seine
Bilder (angefangene und vollendete) und die vielen
Stöße von Zeichnungen; wir sprachen über Kunst und
Literatur, über seinen Lebens- und Studiengang, über
seine Pläne, seine Hoffnungen und Enttäuschungen.
Er gab sich als ein nach vielen Richtungen hin inter-
essierter Geistesmensch, dessen wesentliche Kraft
allerdings auf die Darstellung der visuell erfaßbaren
Welt durch die bildende Kunst gerichtet war. Dabei war
allerdings die Grundauffassung nicht zu leugnen,
daß das Künstlertum als Menschenform höchster
Qualität anzusprechen sei, als eine Form, die sich
generell von Formen anderer Betätigung abhob.
Schiele drängte sich oft das Unterscheidende und
Charakteristische des Künstlers in die Metapher des
Eremiten zusammen und hat es auch so dargestellt.
||
Er kam da einer Auffassung Rilkes nahe, dessen Art
Kunst zu erleben und zu werten bei Schiele merkwürdig
ähnlich wieder aufklingt. Manches aus Rilkes Roman
„Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ findet
sein Analogon in Schieles Werkgesinnung. Es wäre nicht
ausgeschlossen, daß Schiele diese Arbeit Rilkes gekannt
hat (mit Rilkes Gedichten war er immerhin vertraut),
doch reicht die Atmosphäre der Zeit vollständig aus,
die faszinierende Kraft des Häßlichen, die Exklusivität
des Künstlers und einen gewissen Hang zum Narzissmus,
der für diese Zeitspanne bei Rilke charakteristisch wird,
auch bei Schiele irgendwie durchzuspüren. Jedenfalls
war Schiele auch literarischen Einflüssen zugänglich,
wenn auch sein eminent gestalten- und formen-
hungriges Auge ihn davor bewahrt hat, Literatur
auch zu malen.
Doch will ich es mir zum Schluß aufsparen, das
Phänomen Schiele in die Zeit einzuordnen, vor-
läufig soll erzählt werden, daß Schiele noch
einige Zeit seine Freiheit genoß, bis er ur-
||
plötzlich – keiner hätte es für möglich gehalten –
zum Militärdienst für tauglich erklärt und
nach einer für ihn schwierigen Rekrutenaus-
bildung zum Wachdienst bestimmt wurde.
Ursprünglich in der Nähe Wiens stationiert, wurde
er dann in das Kriegsgefangenenlager nach
Mühling kommandiert. Von da ab war es ihm
weder möglich auf längere Zeit nach Wien zu
kommen, noch auch während seiner Dienstzeit sich
regelmäßig und wesentlich in seiner Kunst
zu betätigen. Schiele litt darunter sehr stark;
nur seine Frau, die in der Mühlinger Gegend
sich einquartiert hatte, milderte einigermaßen
seine Isolierung. Aufenthalte in Wien,
Samstag und Sonntag über, genügten nicht,
da kam Schiele eines Tages mit der Bitte zu
mir, ich möge ein Gesuch an das Kriegs-
pressequartier um Versetzung nach Wien
eventuell um Berufung als Kriegsmaler
||
von Gustav Klimt, Josef Hoffmann, Otto Wagner
und Direktor Haberditzl von der Modernen Gale-
rie unterfertigen zu lassen. Ich tat es, aber es hatte
nicht den geringsten Erfolg.
In meiner Ratlosigkeit und Hilfsbereitschaft erzählte
ich einmal den Fall Schiele einem kleinen Oberleut-
nant (Karl Grünwald). Er war vor dem Krieg
Antiquitätenhändler gewesen und war nun bemüht,
mit jungen Leuten der Literatur in Kontakt zu
kommen. Er hatte hiebei den Ehrgeiz, solchen
Künstlernaturen oder was er dafür hielt, nach
Möglichkeit die Härten des Militärdienstes
erleichtern zu helfen.
Sein Einfluß beruhte auf seiner Stellung als
Leiter einer Konsumanstalt zur Belieferung
der Offizierskantinen an der Front. In dieser
seiner Eigenschaft kam er mit vielen hohen Offizie-
ren in Kontakt und traute sich zu, sie gelegent-
lich für kleine persönliche Bitten zugänglich zu
finden, so daß es immerhin nicht leeres Versprechen
||
schien, als er Schiele tröstete und in Aussicht stellte,
ihn von Mühling nach Wien in seine Konsum-
Anstalt transportieren zu lassen. Es war dies
eine weitverzweigte militärische Einkaufs- und
Verteilungsstelle und hatte ihren Sitz und ihre
Magazine im Gebäude der Westbahn-Di-
rektion in der oberen Mariahilferstraße.
Es ging aber leider nicht ganz glatt und zog sich
noch geraume Zeit hin, zumal ja auch für
Schiele ein Ersatzmann nach Mühling ge-
schickt werden mußte. Aber schließlich klappte
es doch und unser Künstler wurde aus dem
Kriegsgefangenenlager an die Konsumanstalt
des Karl Grünwald abgetreten. Seine wunder-
bare Schrift, sein Talent Schilder zu malen, Bücher-
titel und -köpfe zu schreiben, Plakate zu ent-
werfen und ähnliches mehr war angeführt
worden, um die Transferierung auf eine
plausible Formel zu bringen.
||
Da Grünwald sich in der Anstalt bei Schiele mit einem
Minimum von Tätigkeit begnügte, hatte dieser endlich
Zeit, sich wieder mit ganzer Kraft seiner künstlerischen
Arbeit zu widmen, und alles das, was er im letzten
Teil seines Lebens geschaffen hat ist eigentlich (direkt
oder indirekt) der grotesken Tat dieses merkwürdigen
Oberleutnants zu verdanken. Schiele machte auch
Dienstreisen und es gibt hochinteressante Zeichnun-
gen von ihm, welche die Magazine der Konsum-
Anstalt-Zweigstellen Triest und Bozen darstellen.
So war nun Schieles Aufenthalt in Wien dennoch
gesichert, er arbeitete schließlich sogar offiziell für
das Heeresmuseum; und nun lebte er zu-
sehends auf. Er wurde unheimlich produktiv,
nahm sich ein wesentlich größeres Atelier und
hätte nach der ungeheuer erfolgreichen Ausstellung
in der Sezession (im März 1918) alle Voraussetzungen
beisammengehabt für ein neues Leben der Arbeit,
der äußersten Konzentration und des Erfolges,
||
wenn ihn nicht die rapid um sich greifende
spanische Grippe im Herbst 1918 jäh aus der Welt
gerissen hätte.
Es war tragisch, daß er wenige Tage seiner
Frau, die er unendlich liebte und die von der-
selben Krankheit ergriffen worden war, nach-
starb und daß sie – gesegneten Leibes – auch
die Hoffnung auf ein Kind mit ins Grab nahm.
Dieser Tod seiner ganzen Familie gehört
irgendwie zu seinem Wesen, so wie das meteor-
hafte Dahinrasen seiner Existenz zu seinem
Werk paßt. Er setzte sich mit allen Nerven und
allen Fasern seiner Physis zu, um das zu
schaffen, wozu er sich berufen fühlte; es war
eine Einheit in ihm von Leben und Werk.
Ein Frühvollendeter – wenn auch kein Krieg
gewesen wäre. Ein stark aus tiefsten Tiefen
lebender; einer, den die heilige Mania den
Weg trieb, über den es für ihn keinen Augenblick
lang einen Zweifel gab.
||
Es ist schon angedeutet worden, daß Schiele eine bis in
den Kern seines Wesens einzigartige Persönlichkeit war.
Wer ihn von Klimt nicht abzulösen vermag, der tut
ihm bitter unrecht, denn Schiele war viel standfester,
viel realitätshungriger und sinnenfreudiger als
Klimt. Das erweist sich an ihrem Verhältnis zum
Ornament. Das schmückende Beiwerk konnte
bei Klimt die ganze Bildfläche fast überwachsen,
es sparten sich nur die Gesichter, die Hände und
Arme aus, Schiele aber hat diese sekundären
Schößlinge immer zu bändigen verstanden.
Er war hungrig nach dem lebendigen Objekt, Klimt
war es nicht, er ließ sich nicht selten dazu verleiten,
es ihm [im] anorganischen Ornament zu verbergen.
Schiele war Expressionist – wenn man will, aber er
hat den ganzen Schatz des künstlerischen Ausdrucks
geerbt und angewendet und versperrte sich in
keine Schultheorien, er schuf sich die Technik, die
seinem Wesen und seinen Absichten am ehesten
entsprach. Für ihn gab es nur Eins: das tief
ergriffene, begeisterte Schauen, das Bekennen
||
aller Lust, aller Qual, aller Ängste und Herrlichkeiten.
Diese Sucht zu schauen und möglichst viel zu erschauen
läßt ihn die Draufsichten wählen. Er selbst sagte mir
einmal auf die Frage, warum er so gerne Menschen
und Dinge von obenher darstelle, er tue das, weil
man von ihnen auf diese Weise mehr sehe und
weil ihn diese Sicht ob ihrer besonderen Eigenart
am meisten reize. Auf meine Bemerkung hin,
ob diese Methode zu schauen von Brueghel etwa
angeregt sei, sagte er: „Eigentlich nicht, das hat sich
mir in Krumau aufgedrängt. Dort lernt man die Welt
von obenher betrachten und in der Ausgefallheit [!]
solcher Schau, im Ungewöhnlichen der Draufsichten
einen malerischen und zeichnerischen Wert schätzen.“
Merkwürdig ist es jedenfalls, daß Schiele in dieser Art zum
Objekt zu stehen ein brauchbares Mittel für seinen
künstlerischen Aneignungstrieb spürt, eine be-
sondere Methode bildnerischer Bewältigung der
Außenwelt.
Auf die Verwandtschaft mir Rilkes „Malte“ ist schon
hingewiesen worden, ich glaube aber hierin weniger
||
auf eine literarische Beeinflussung schließen zu dürfen
als auf ein Motiv der Zeit als solcher, die die Kunst
ganz ins Individuelle hineingenommen und dadurch
förmlich isoliert hat. Der Künstler jener Generation, der
Schiele angehörte, diente der Kunst als einer besonderen
Form von Besessenheit, die ihn von allen andern mit-
leidslos ausschloß. Die Folge davon war, daß der Künst-
ler der feindseligen Reaktion der Nichtkünstler jeweils
immer zuvorzukommen strebte und seinerseits schon
zunächst exklusiv und dann abschätzig gegen die
„Andern“, die „Philister“ sich einstellte und auf die
„Uneingeweihten“ herabsah. Der Begriff des schöpfe-
rischen Menschen als der sich der Künstler dieser Epoche
empfand, hatte etwas vom Weltschöpfer an sich,
enthob ihn aller kleinlichen Rücksichten und Ab-
hängigkeiten und machte ihn reif für kühne Kon-
struktionen einer abenteuernden Anatomie im
Dienste eines dämonischen Schaffensdranges.
In Einsamkeit und Abgetrenntheit von der Gemein-
schaft der Vielen, eigenbewertet, ja überwertet, weil
ein Auserwählter des Schicksals, ja ein gezeichneter –
war der Künstler zugleich ein Ausgestoßener, der
||
diesen reinen Fluch wie ein Narkotikum zu genießen
verstand.
Die natürliche Sinnlichkeit des Schaffenden ver-
einigte sich mit der intellektuellen Bereitschaft
einer zu Ende gehenden Kultur zu einer faszi-
nierenden Abenteuerlust und Experimentier-
freudigkeit, die sich nicht sattsehen konnte an den
grotesken, an den häßlichen, an den abnormen
Formen alles Außenseitigen und Problematischen.
Es war nicht die „Verruchtheit“ des nur intellektu-
ellen Snobs, sondern ein echt künstlerischer
Zwang und eine Entdeckerfreudigkeit, die sich
nicht genugtun konnte im Öffnen von ge-
heimen Türen und Schlössern und die schwer
beladen mit Erlebnissen zurückkam von ihren
Beutezügen in die Grenzgebiete des Menschlichen
und Allzumenschlichen.
Aber vergessen wir darob das Andere nicht.
Sosehr dieses Abenteuernde und Zentrifugale
auch zu Schiele und seiner Wesensart gehörte,
so war er doch auch nicht unempfindlich
||
gegen die großen und einfachen Zeugen ungebeugter und
reiner Natürlichkeit. Er kennt die Freude an der naiven
Buntheit eines Stückes Welt, er kann sich einem „Ding“
gegenüber so in helle Begeisterung hineinsteigern,
weil er es mit den seeligen Augen seines künstleri-
schen Temperamentes ansieht und etwa in einer wie mit
Aussatz befallenen Mauer oder in einem wackeligen
Zaun die ewigen Farben- und Schattenspiele ent-
deckt, die die andern nur den großen, den feierlichen,
den heroischen Objekten vorbehalten glauben.
Schiele hat aber auch noch ein Drittes darzustellen
vermocht: die Angst und Ausgesetztheit der
menschlichen Existenz, was wiederum ein echt
Rilkesches Motiv wäre. Das Geheimnisvolle des
Todes und das Rätselhafte und im Letzten doch
Unzugängliche des Lebens haben ihn nicht selten
beunruhigt und er hat mit einer verhaltenen
Bangnis darauf reagiert. Leidvolle Züge sind
in sein Antlitz eingetragen und schwere Trau-
rigkeit redet aus seinem Blick als wüßte er,
daß er an die blutigste Schwelle der Menschheits-
geschichte zu stehen gekommen sei.
||
Aber wenn er auch das Kind einer versinkenden
Kultur war und der Künstler einer Zeit, die sich
aus Sterben gemacht hatte, so war er doch auch der
zeitlose Künstler, der absolute, der, wo immer
das Schicksal ihn hinstellt, die ganze und ewige
Wahrheit zu sagen vermag. In dieser Hingabe,
in diesem Wagemut und in dieser sich selbstver-
brennenden Opferfreudigkeit ist er zeitlos und
allen schaffenden Geistern ebenbürtig.
Er hatte die Aufgabe, was Besonderes zu sagen
und er hat es auch auf besondere Weise gesagt.
Schiele als Maler in allen Ehren – aber war er nicht
auch als Maler ein Graphiker, bis zu einem
gewissen Grade wenigstens? Blieb er nicht überall
dem Reiz des Konturs, jedem Zauber des Strichs
ausgeliefert? Er war ein Hymniker der Kurven
und Überschneidungen, ein Lyriker des Strichs,
dessen Musikalität zu empfinden er uns wieder
gelehrt hat.
||
Wenn ich mich ganz zurückdenke an den Zauber seines
Umgangs, in die wunderbare Art seiner Arbeitsweise,
so möchte ich ihn grüßen als einen von weither. Denn
eigentlich war er das und ist es immer geblieben.
Die Stöße Deiner Zeichnungen zu durchblättern,
würde ich sagen, wird den Eingeweihten immer
ein Genuß sein, aber nur den Auserwählten,
denn Du warst nicht berufen „Stimme des Volkes“
zu sein. Was Du uns sagtest, wäre oft und oft
im Maul des Alltags zur Zote geworden und
das naive Gemüt hätte an Dir Schaden ge-
nommen, so problematisch warst du im Grunde
doch.
Warst Du ein Künstler, der in eine neue Zukunft
wirken wollte? Ich glaube es nicht, jedenfalls war
es Dir nicht vergönnt gewesen auch nur dazu
anzusetzen. Noch warst du immer (solange Du
lebtest) zur Vergangenheit zurückgewendet und
hast ihr auf Deine Weise den Epilog gehalten.
Dabei hat das Schicksal dich unterbrochen, hat Dich
uns entführt und wir haben das Nachsehen
gehabt.
||
Du entschwandest uns und dann ward Winter.
Was inzwischen wie Frühling und Reife und Ernte
aussah, das war Täuschung, es ist Spätherbst und
Winter geblieben, und was wir haben, ist das Erbe
einer nun toten Vergangenheit. Bringen wirs
noch hinüber ans andere Ufer? retten wirs?
Gibts drüben noch Menschen, denen das etwas
zu sagen hat, was uns teuer war?
Wie hat sich vor Dir die mystische Landschaft
eines Menschenantlitzes aufgetan mit ihren
Gräbern und Hügeln, ihren Schluchten und
Faltengebirgen. Was sahst Du alles in einer
Baumrinde, an einem Lattenzaun. Welche
Farbenwunder lasest Du von der menschlichen
Epidermis, gleichgiltig [!] ob sie jung war, voll
strotzenden Lebens oder brüchig und morsch voll
Knoten und Runzeln. Alles war Dir Schauspiel
und Wunder, zu dem Du als Zeuge gerufen warst,
es ging ein zu Deinem Auge, um aufbewahrt zu
werden in der Schatzkammer Deiner dämonischen
||
Phantasie. Dort blieb Alles und wartete bis Du
es brauchtest. Wie herrlich war es dann, wenn Du
nach dem Zeichenstifte griffest, ihn ansetztest und
im kühnen Zuge über das weiße Blatt führtest: von
unten nach oben oder rechts nach links!
Du warst voller Figur und hattest die Welt in
Dir, Deine Welt. Sie ist uns wertvoll und kostbar
um des hohen Bekennermutes willen, mit dem Du
sie dargestellt hast auf der kurzen Strecke Deines
irdischen Lebens: meteorgleich am Widerstand
unserer Atmosphäre aufbrennend, ein Welten-
wanderer von weither, ein flüchtiger Gast, ein
schon wieder Entschwundener.
Wien, im November 1943.
Leopold Liegler
Eigentümer*in
Autor*in
Erwähnte Institution
Abbildungsnachweis
Albertina, Wien
Verknüpfte Objekte
PURL: https://www.egonschiele.at/2565