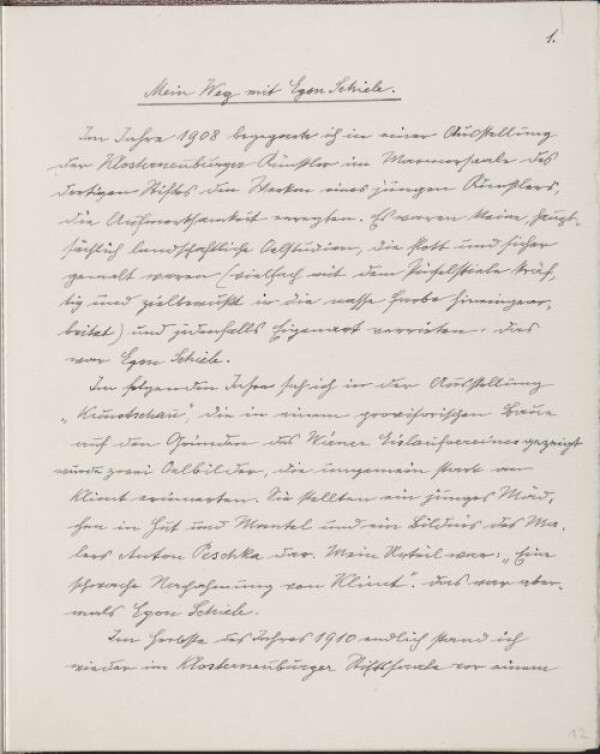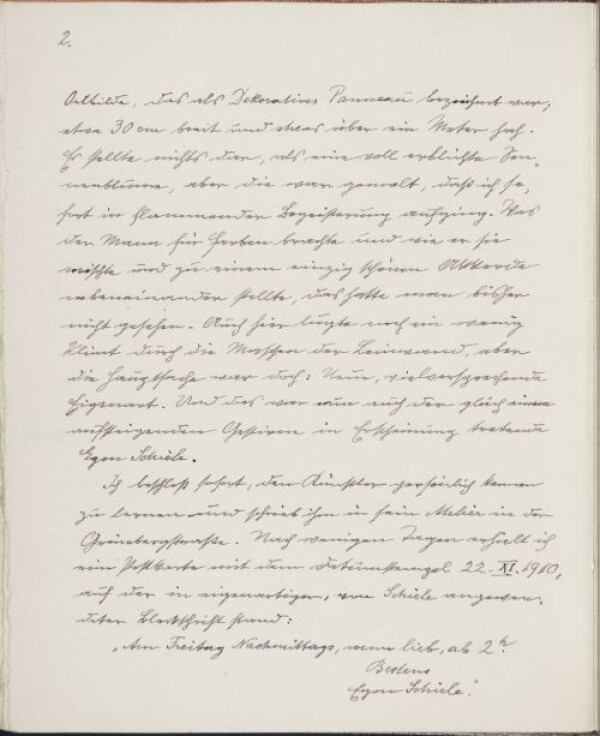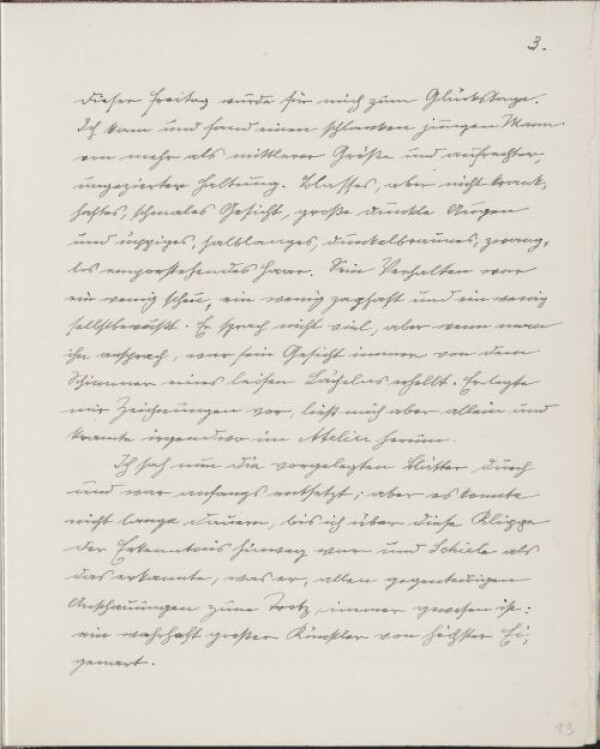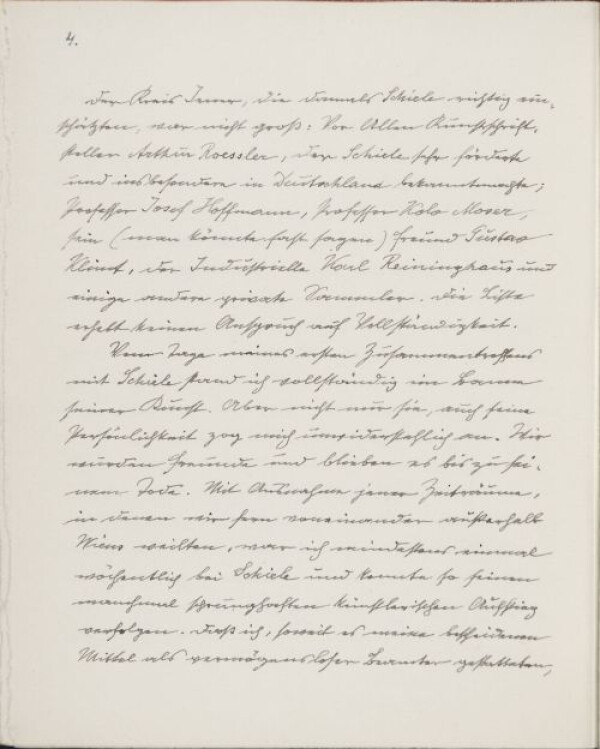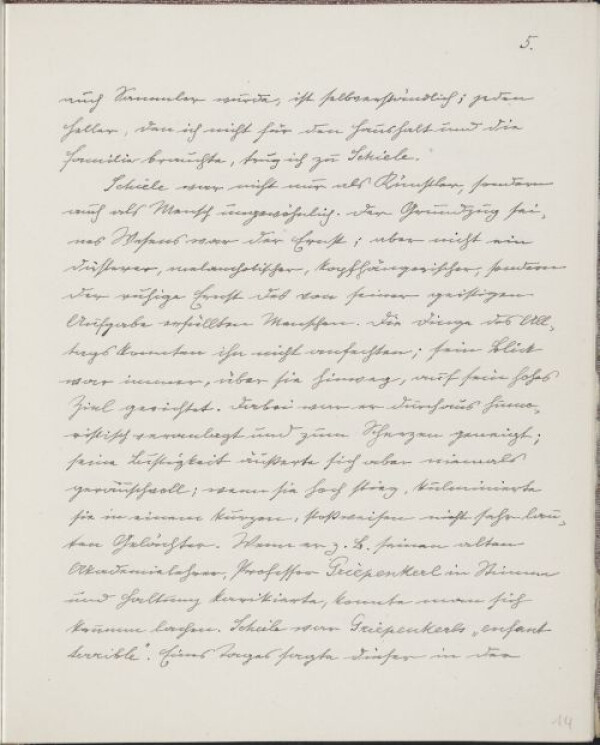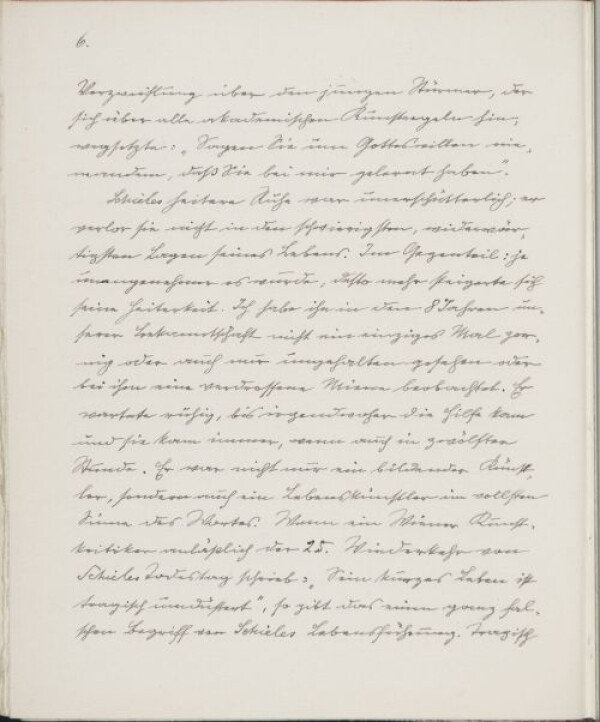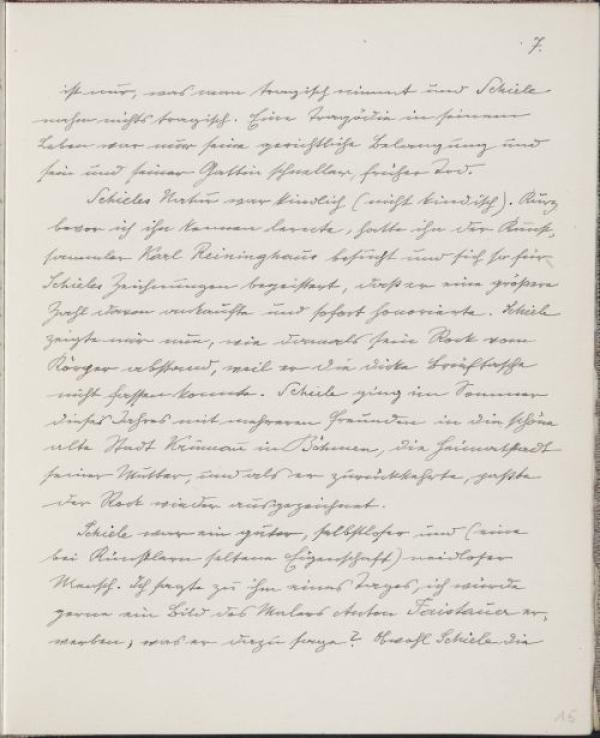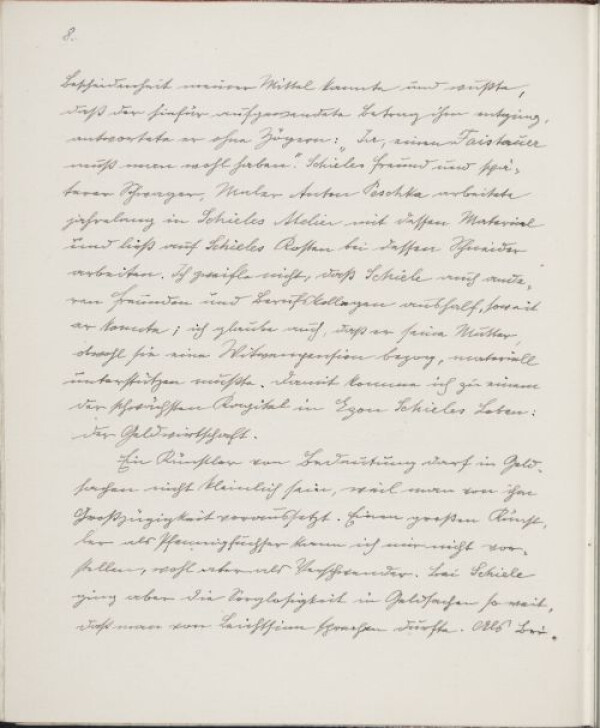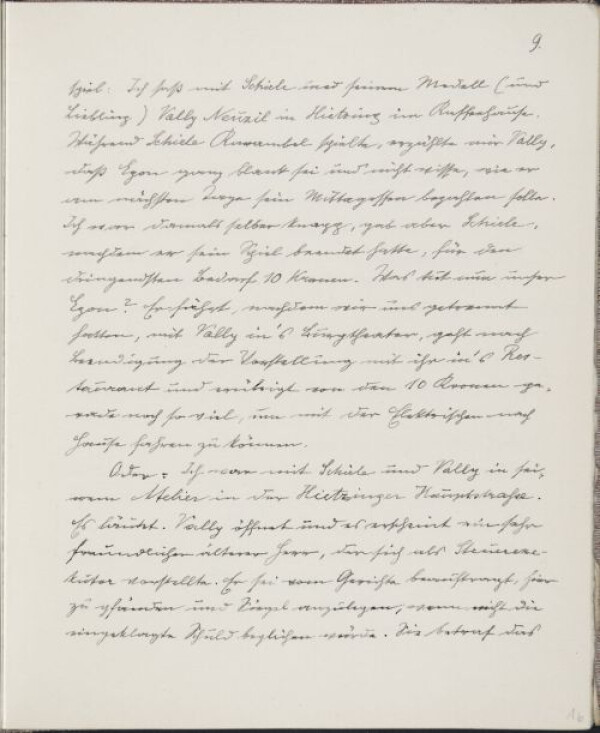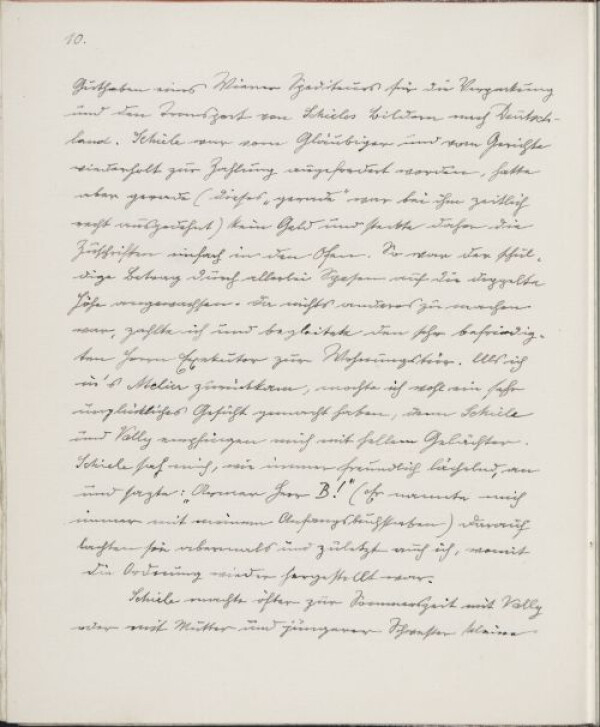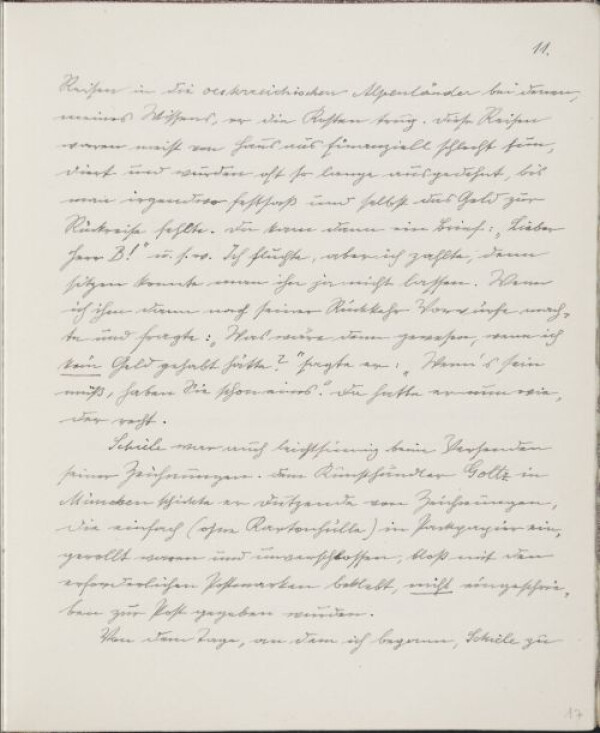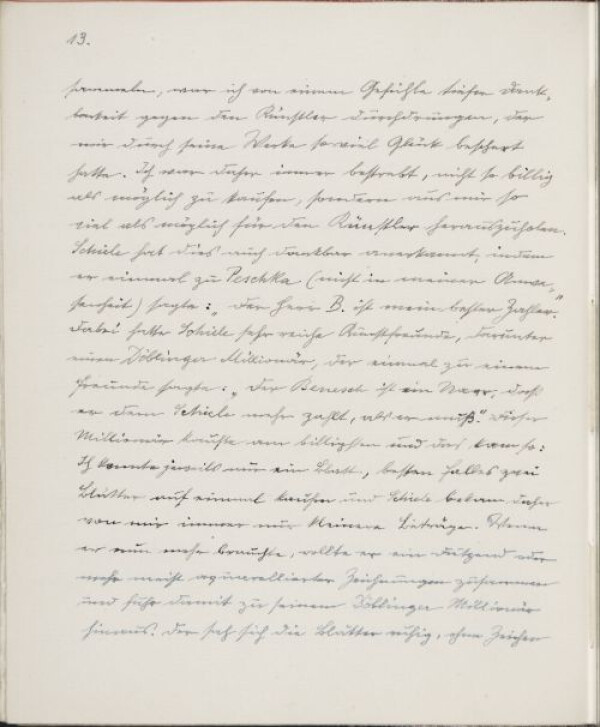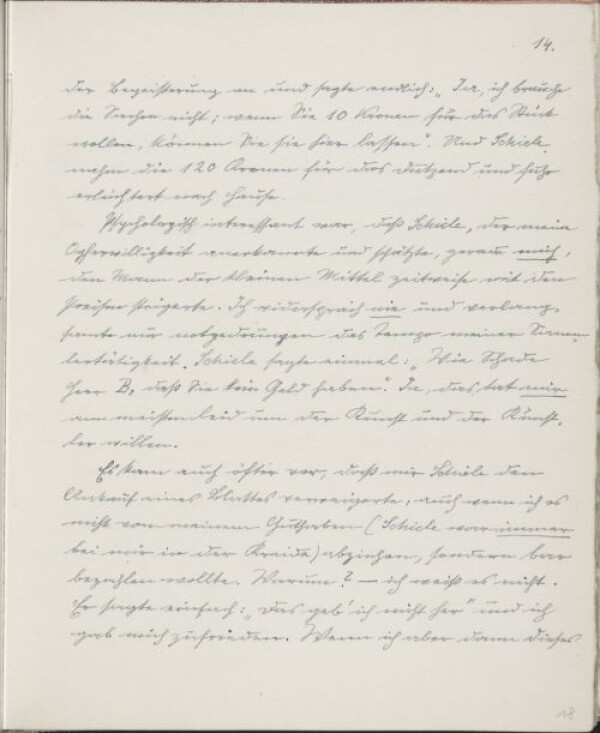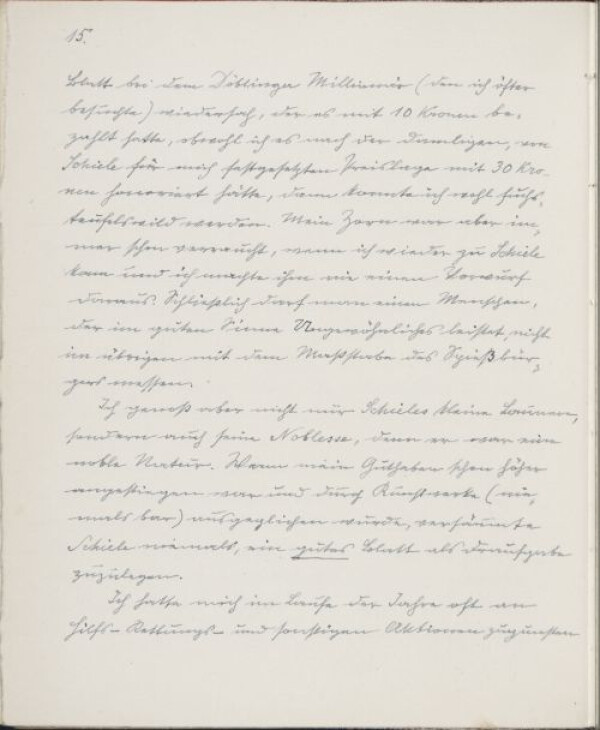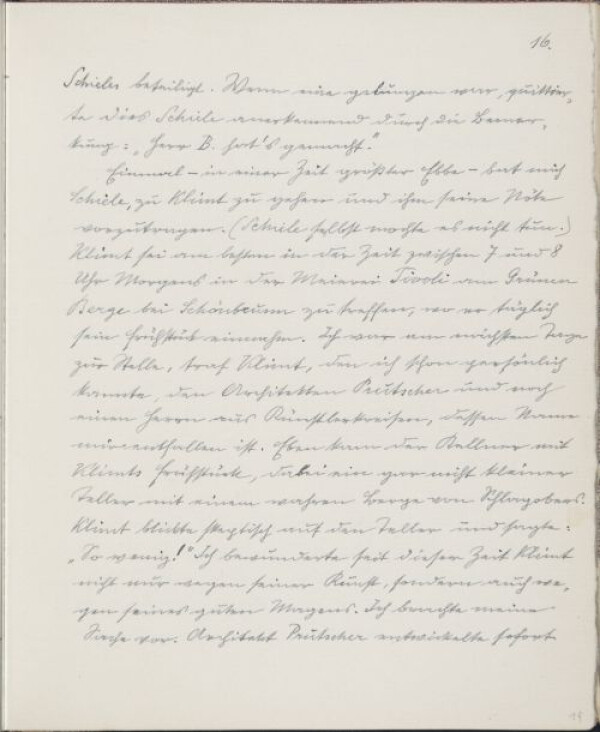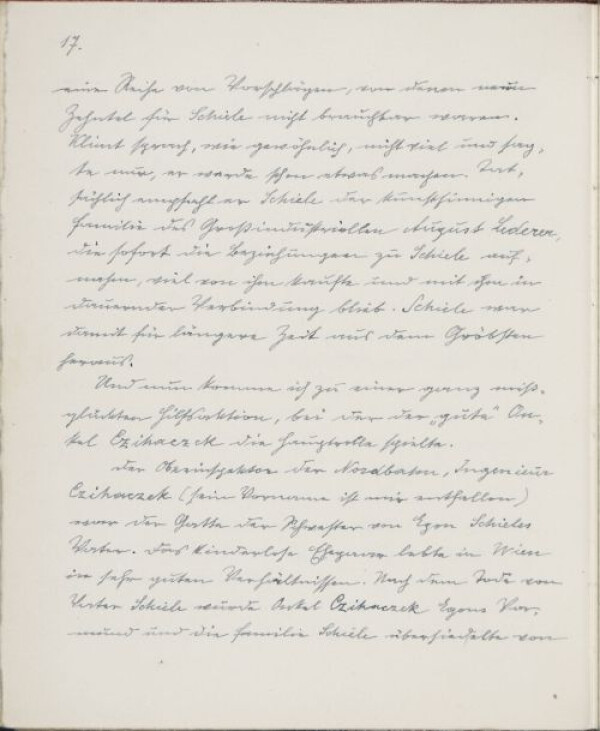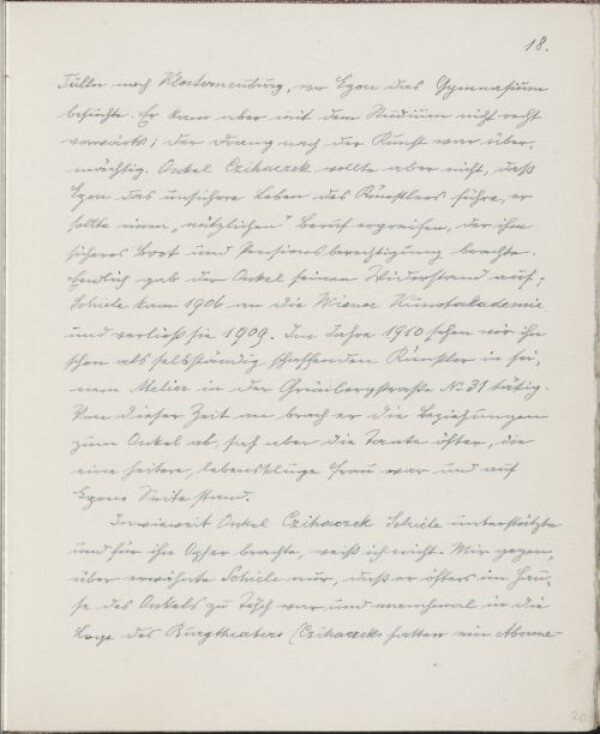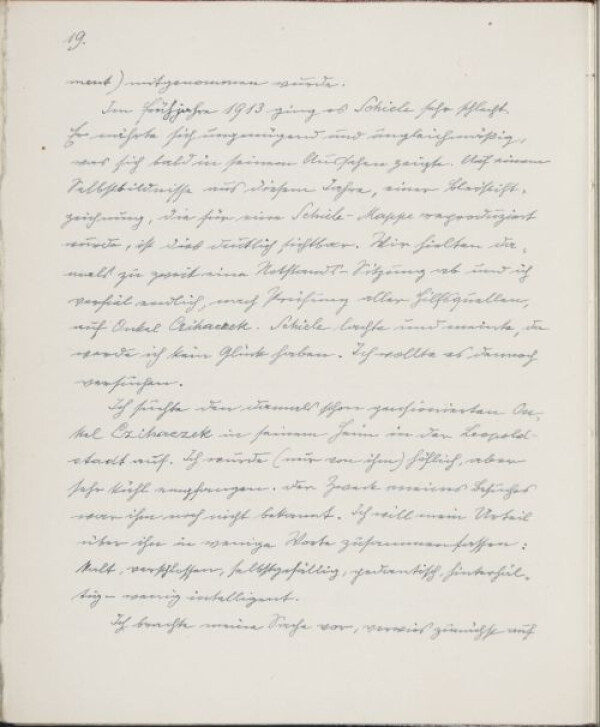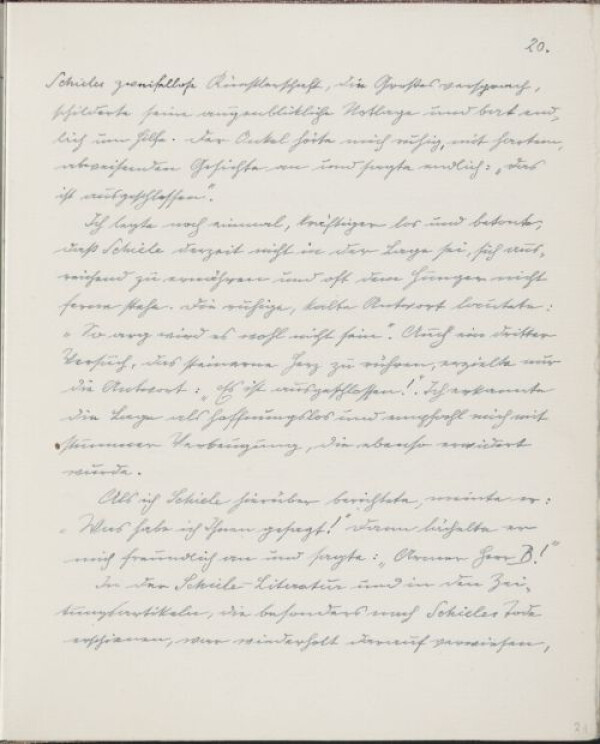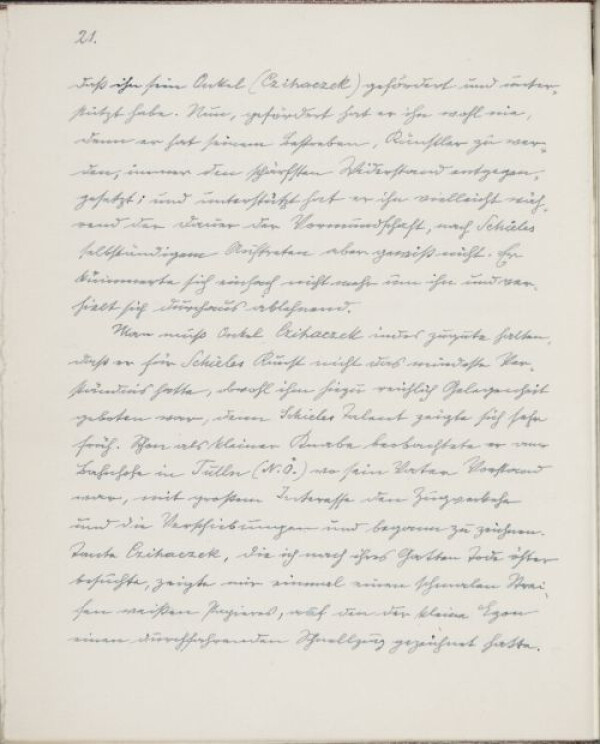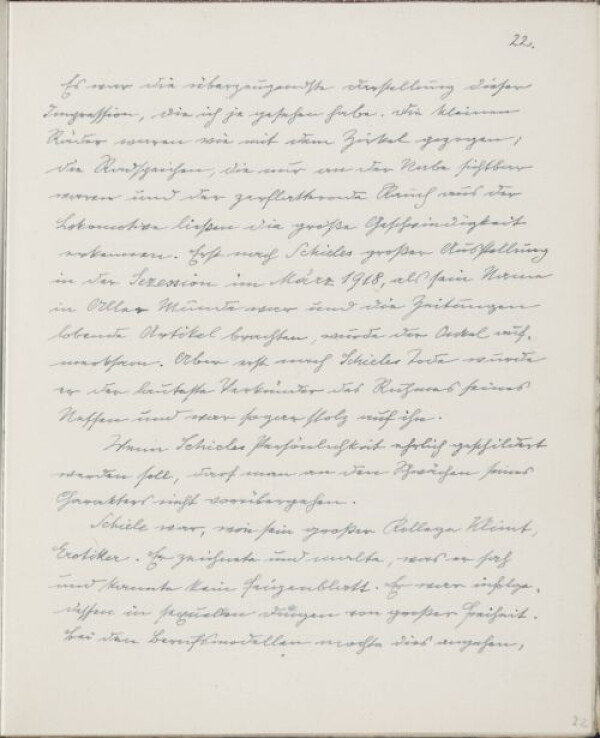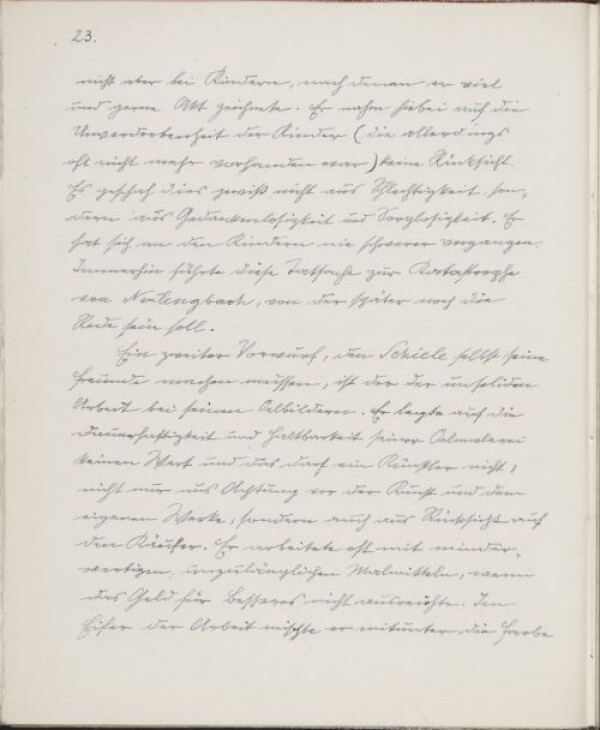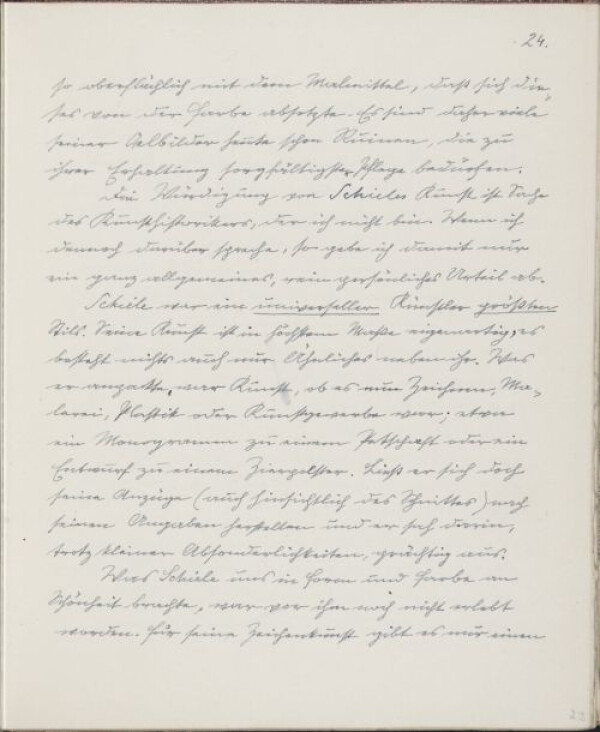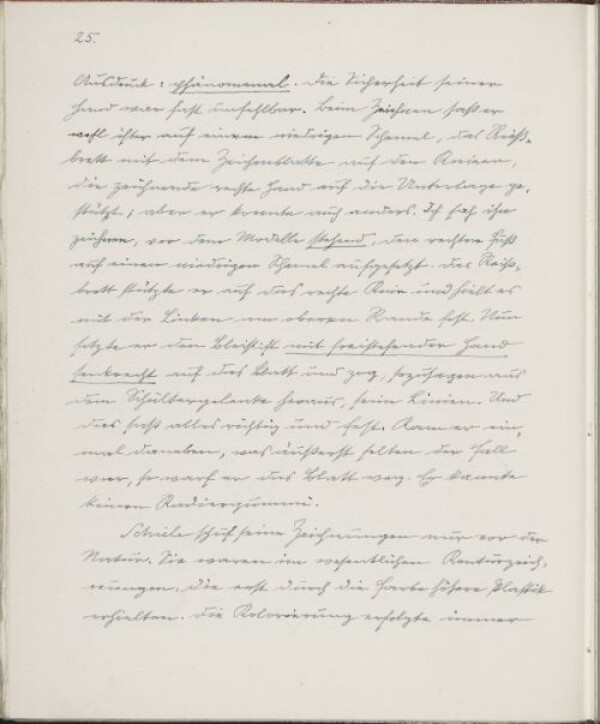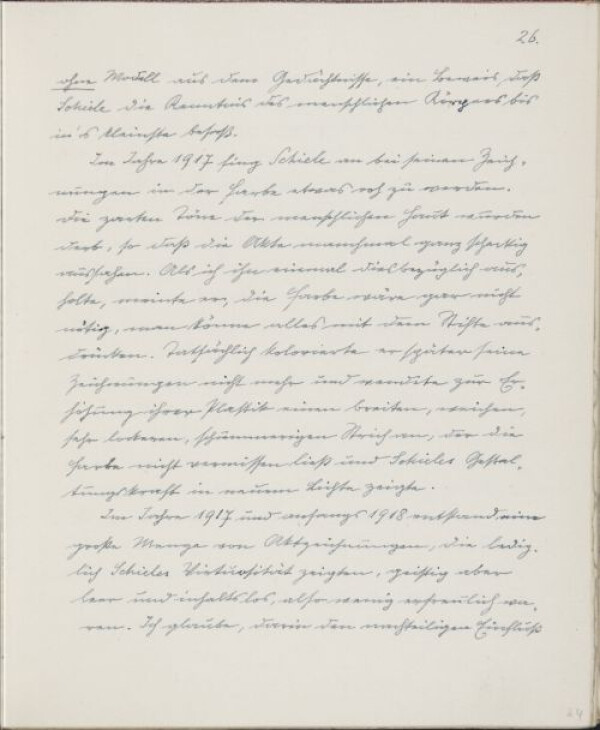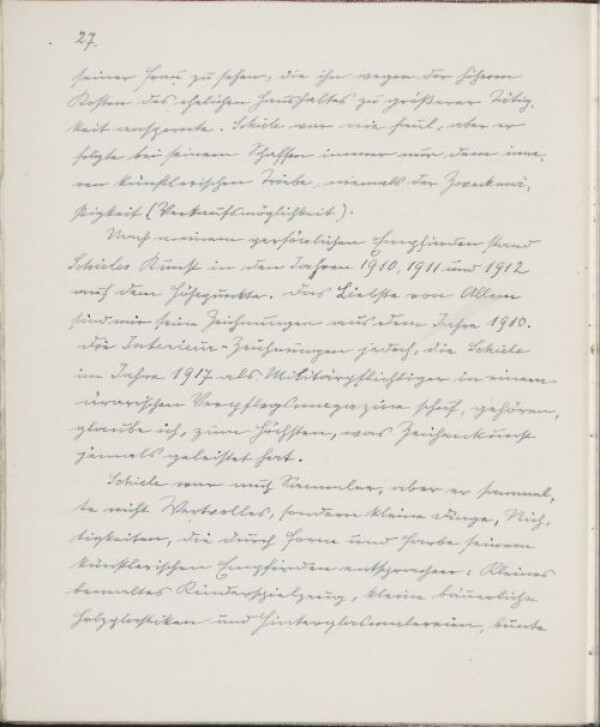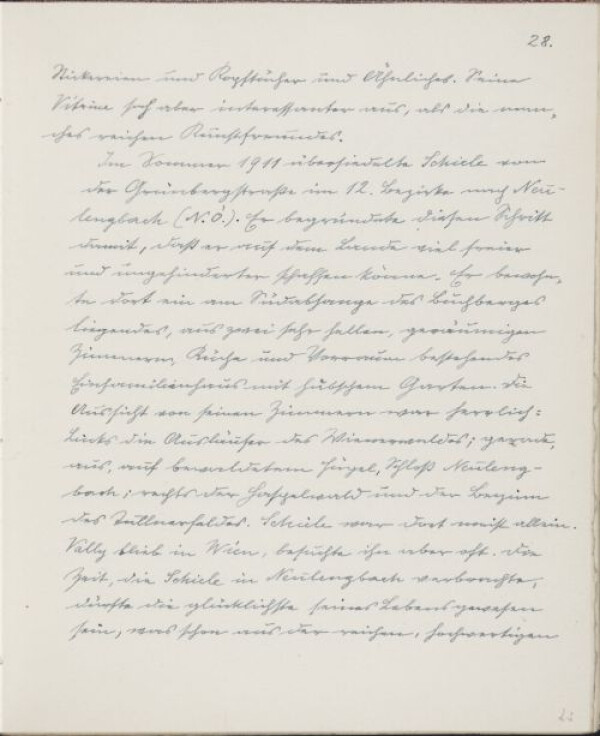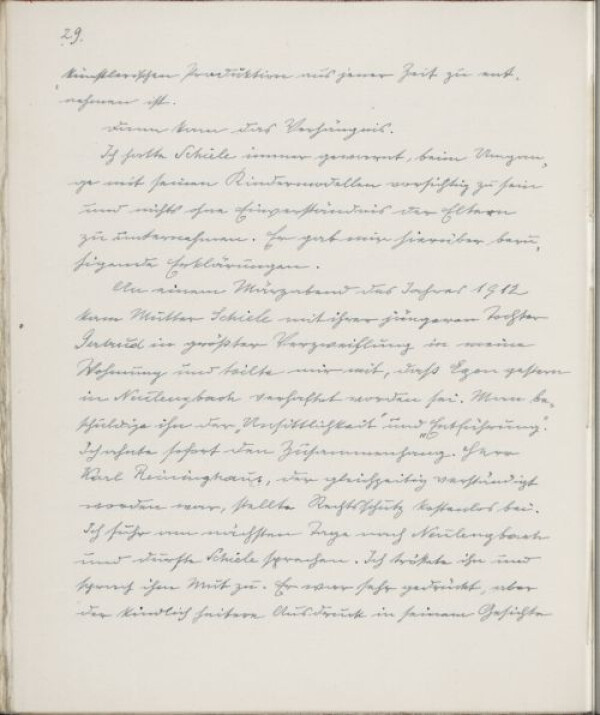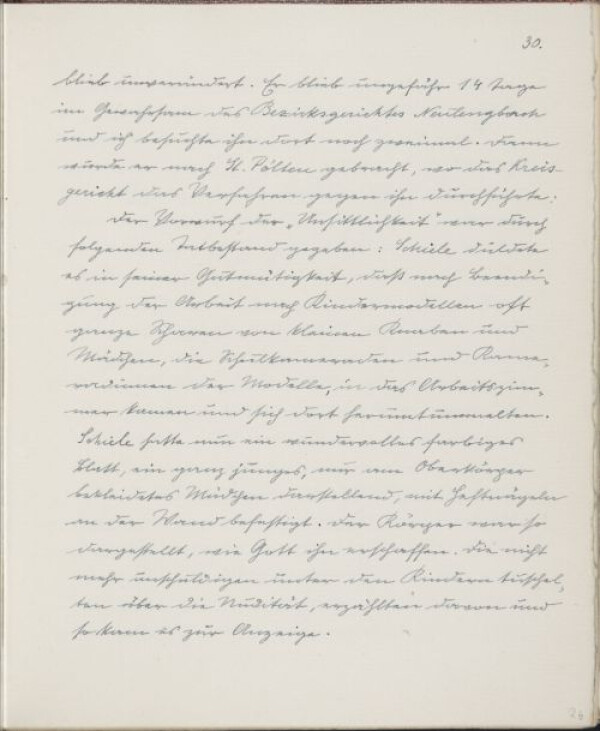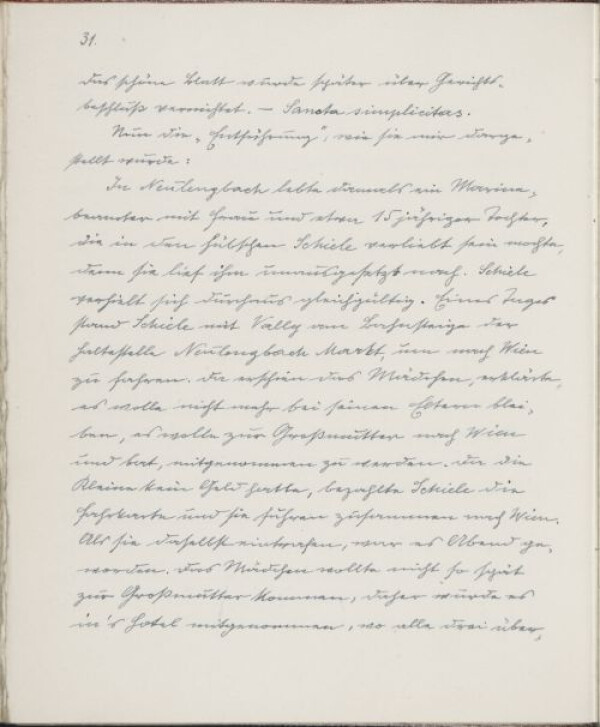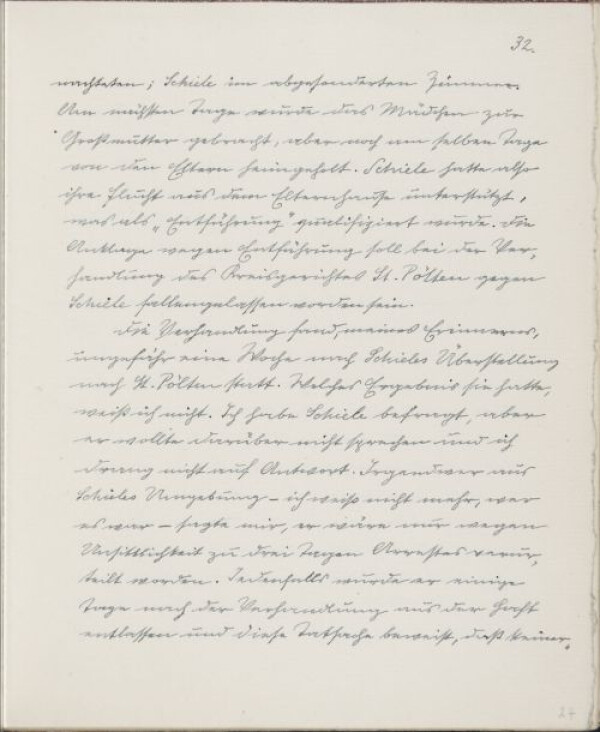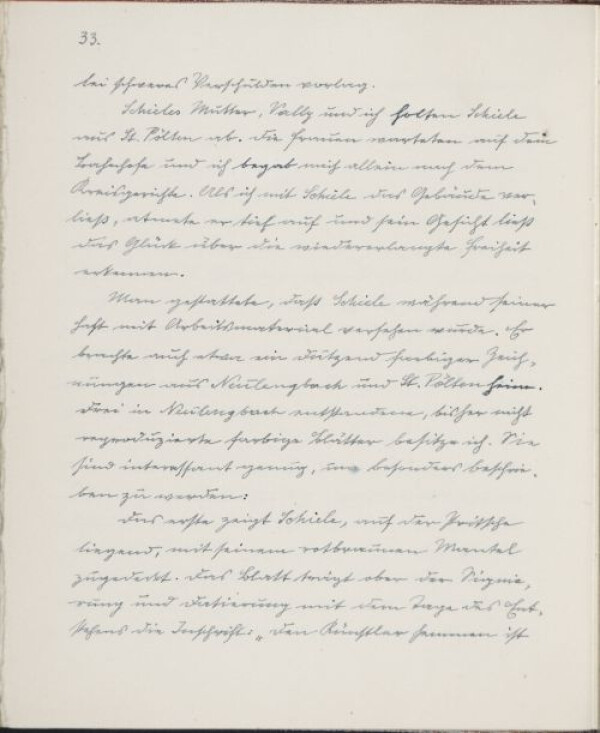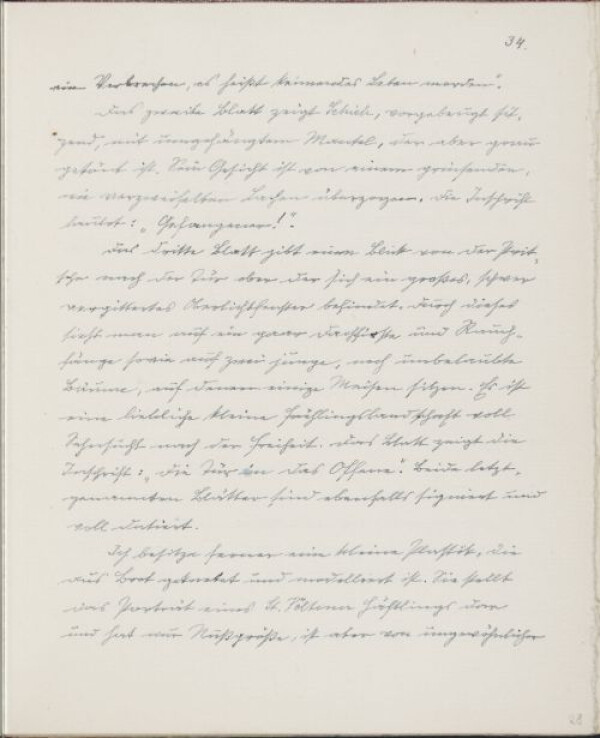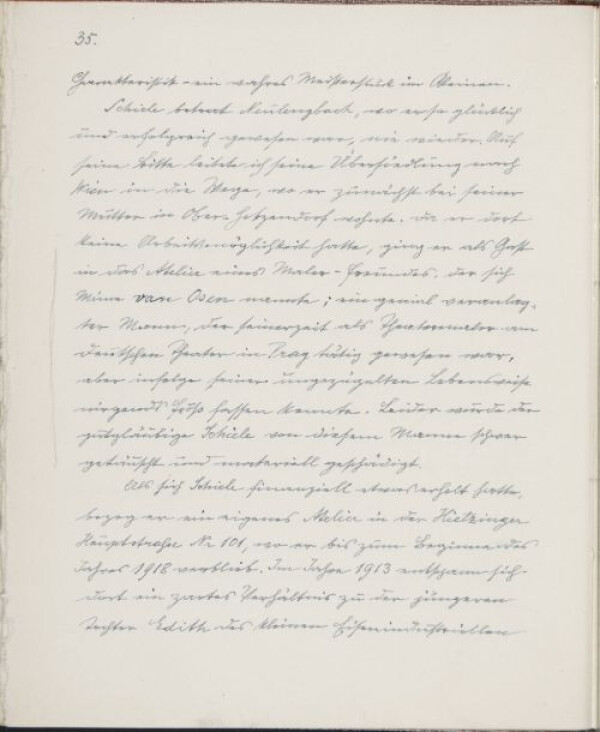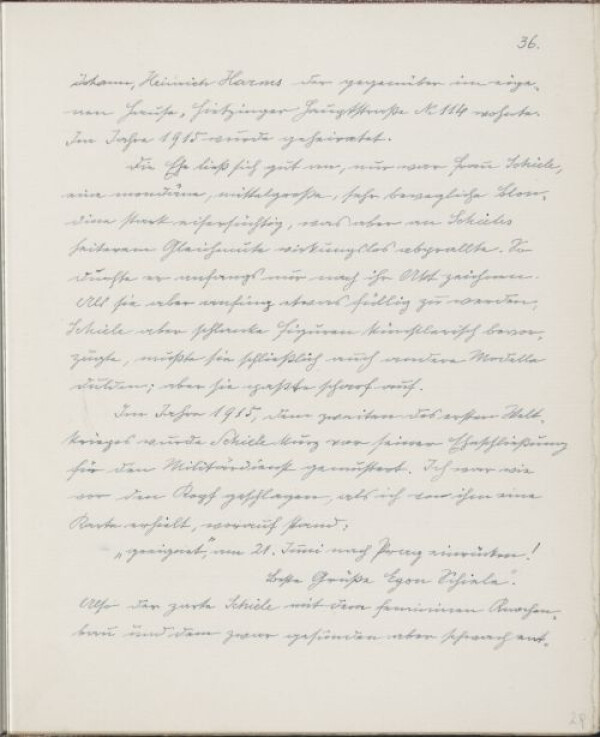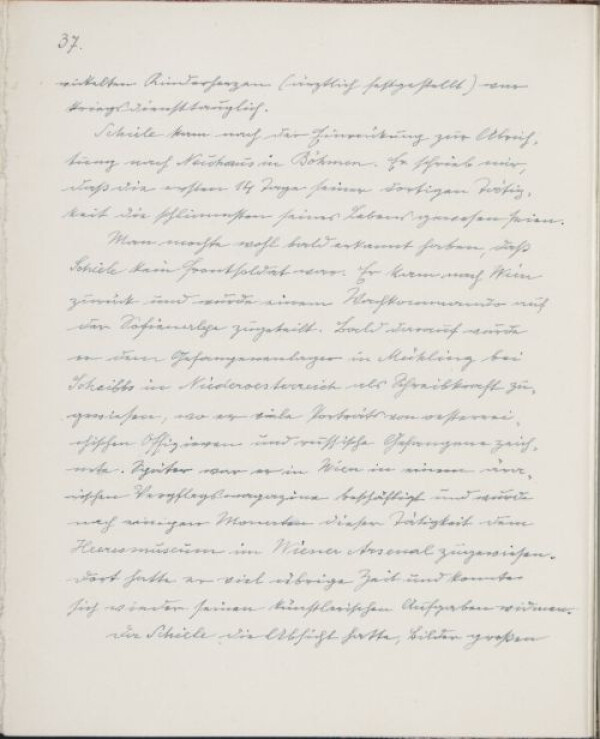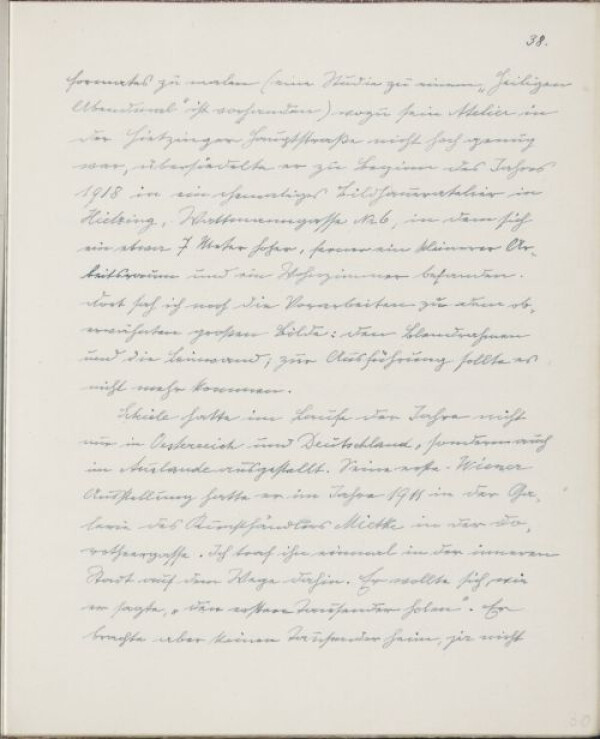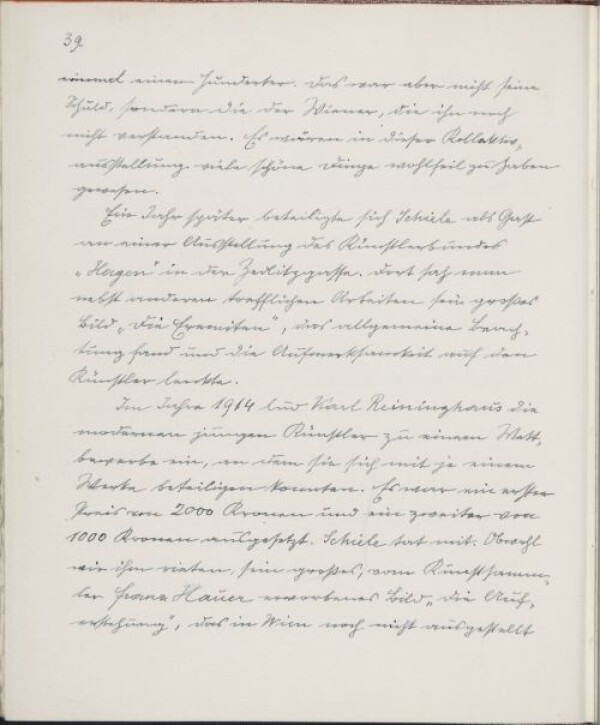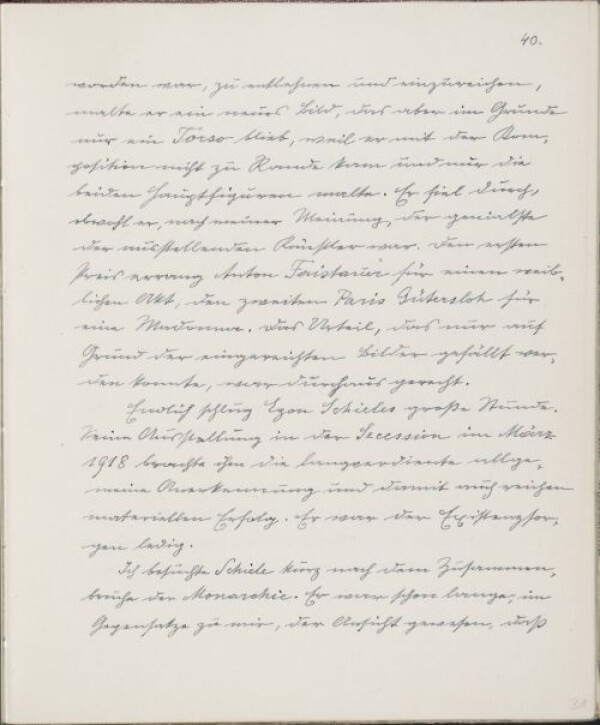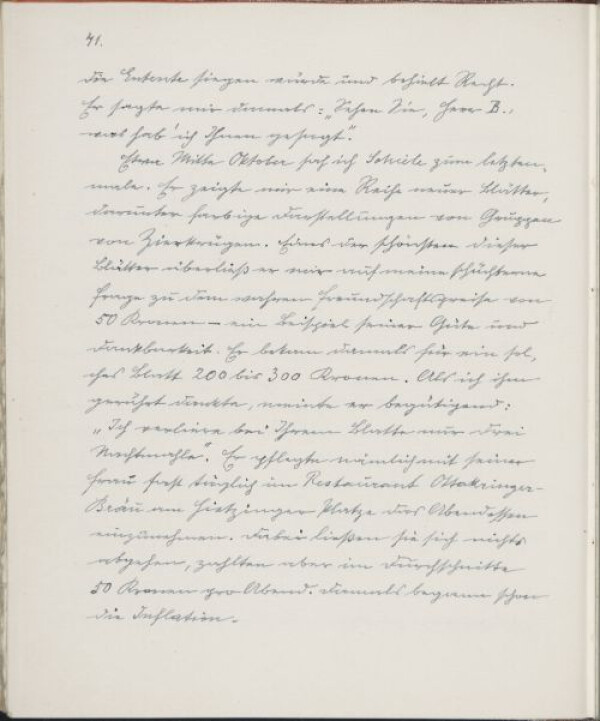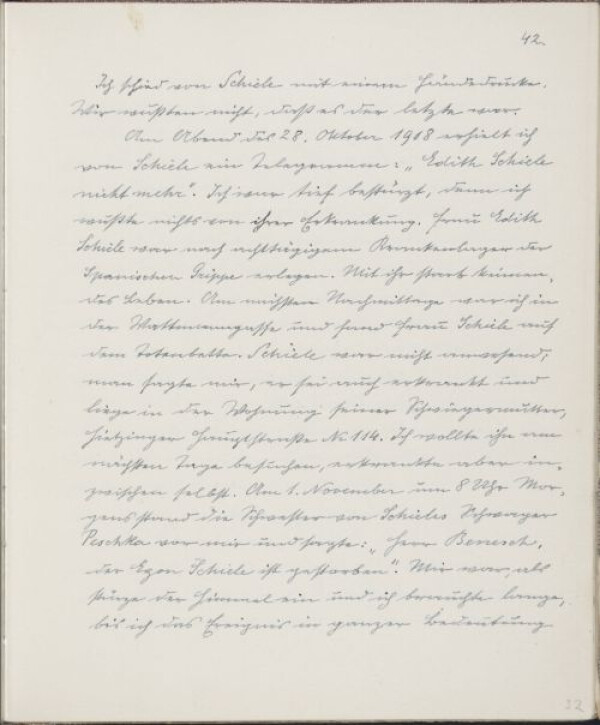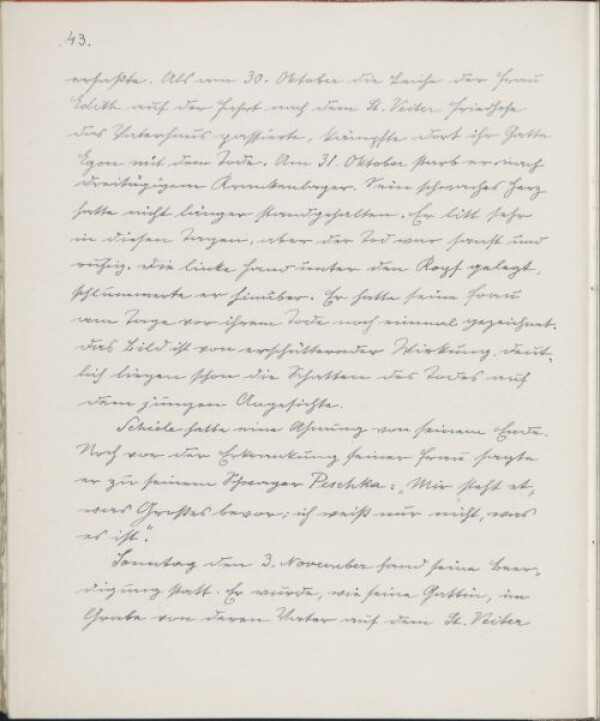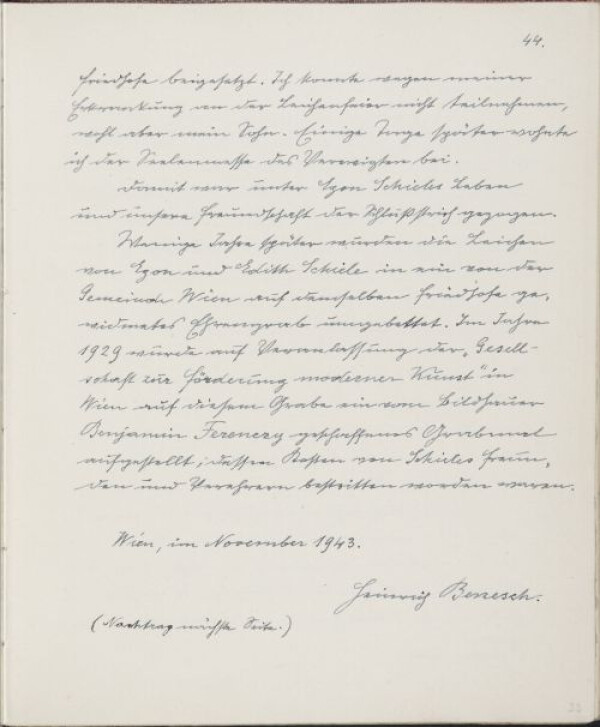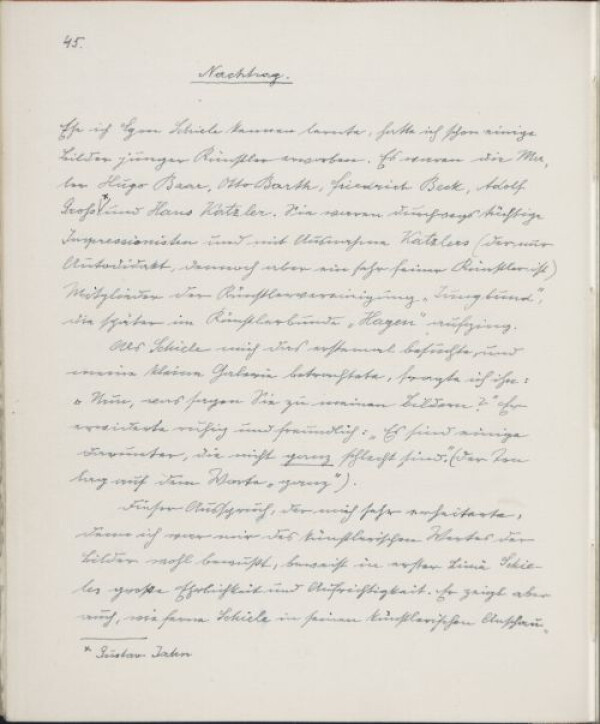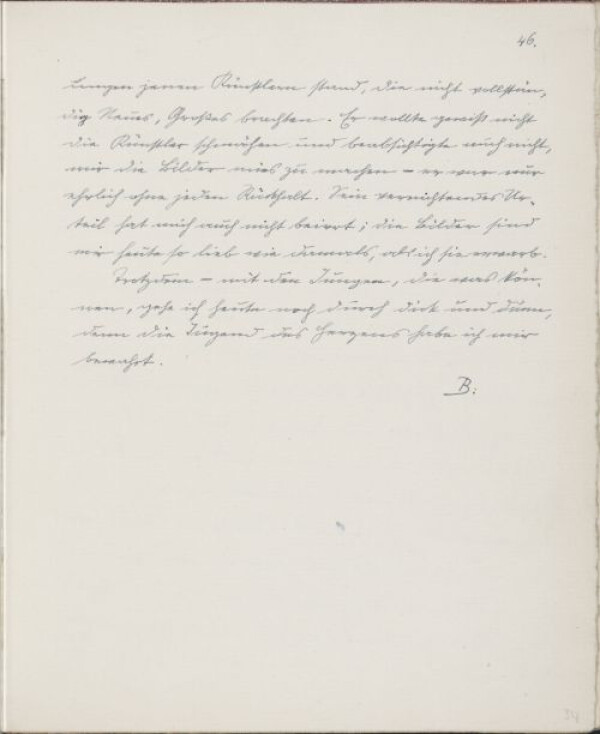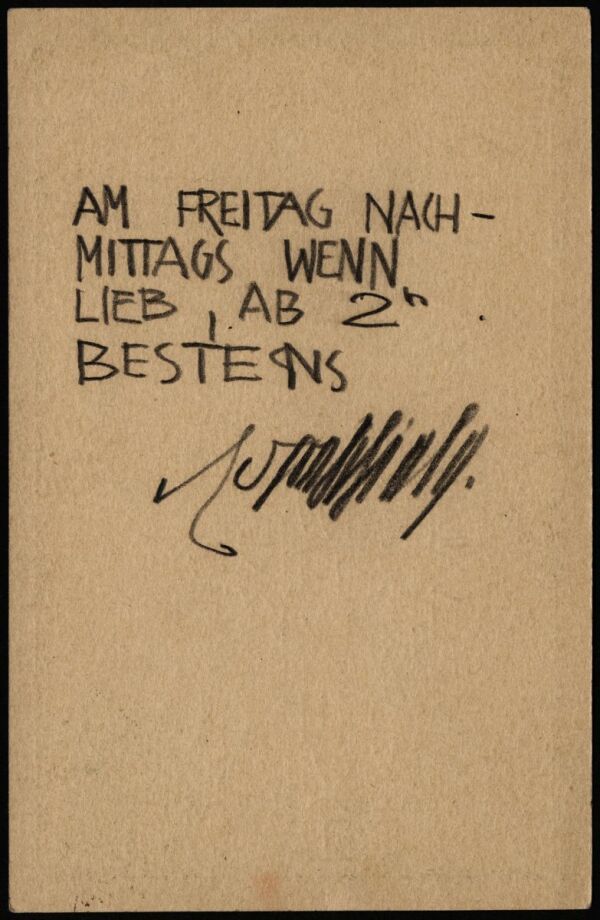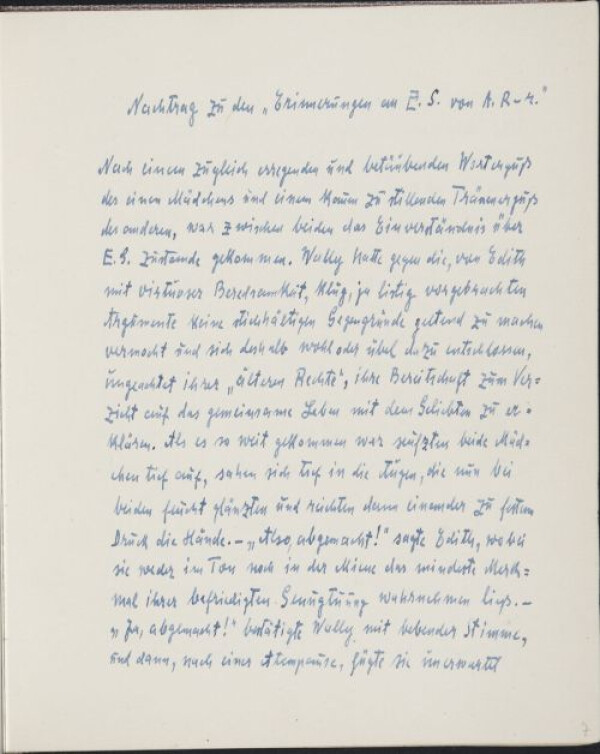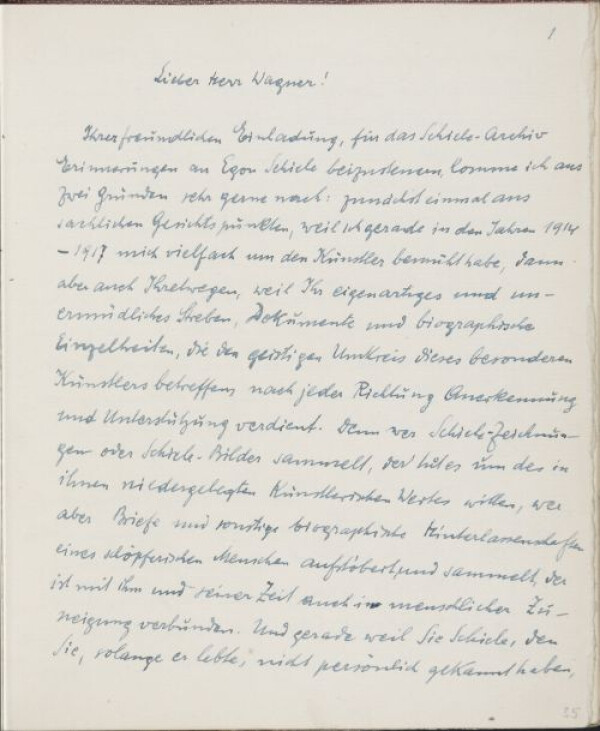Beitrag von Heinrich Benesch für das „Erinnerungsbuch Egon Schiele“
1 / 45
Albertina, Wien
ESDA ID
2564
Nebehay 1979
Nicht gelistet/Not listed
Bestandsnachweis
Albertina, Wien, Inv. ESA 508/12–34
Datierung
1943 (inhaltlich)
Material/Technik
Schwarze Tinte auf Papier
Maße
19 x 15,5 cm (Seite)
Transkription
1.
Mein Weg mit Egon Schiele.
Im Jahre 1908 begegnete ich in einer Ausstellung
der Klosterneuburger Künstler im Marmorsaal des
dortigen Stiftes den Werken eines jungen Künstlers,
die Aufmerksamkeit erregten. Es waren kleine, haupt-
sächlich landschaftliche Oelstudien, die flott und sicher
gemalt waren (vielleicht mit dem Pinselstiele kräf-
tig und zielbewußt in die nasse Farbe hineingear-
beitet) und jedenfalls Eigenart verrieten. Das
war Egon Schiele.
Im folgenden Jahre sah ich in der Ausstellung
„Kunstschau“, die in einem provisorischen Baue
auf den Gründen des Wiener Eislaufvereins gezeigt
wurde zwei Oelbilder, die ungemein stark an
Klimt erinnerten. sie stellten ein junges Mäd-
chen in Hut und Mantel und ein Bildnis des Ma-
lers Anton Peschka dar. Mein Urteil war: „Eine
schwache Nachahmung von Klimt.“ Das war aber-
mals Egon Schiele.
Im Herbste des Jahres 1910 endlich stand ich
wieder im Klosterneuburger Stiftssaale vor einem
||
2.
Oelbilde, das als Dekoratives Panneau bezeichnet war;
etwa 30 cm breit und etwas über ein Meter hoch.
Es stellte nichts dar, als eine voll erblühte Son-
nenblume, aber die war gemalt, daß ich so-
fort in flammender Begeisterung aufging. Was
der Mann für Farben brachte und wie er sie
mischte und zu einem einzig schönen Akkorde
nebeneinander stellte, das hatte man bisher
nicht gesehen. Auch hier lugte noch ein wenig
Klimt durch die Maschen der Leinwand, aber
die Hauptsache war doch: Neue, vielversprechende
Eigenart. Und das war nun auch der gleich einem
aufsteigenden Gestirn in Erscheinung tretende
Egon Schiele.
Ich beschloß sofort, den Künstler persönlich kennen
zu lernen und schrieb ihm in sein Atelier in der
Grünbergstraße. Nach wenigen Tagen erhielt ich
eine Postkarte mit dem Datumstempel 22. XI. 1910 [1],
auf der in eigenartiger, von Schiele angewen-
deter Blockschrift stand:
„Am Freitag Nachmittags, wenn lieb, ab 2h.
Bestens
Egon Schiele.“
||
3.
Dieser Freitag wurde für mich zum Geburtstage.
Ich kam und fand einen schlanken jungen Mann
von mehr als mittlerer Größe und aufrechter,
ungezierter Haltung. Blasses, aber nicht krank-
haftes, schmales Gesicht, große dunkle Augen
und üppiges, halblanges, dunkelbraunes, zwang-
los emporstehendes Haar. Sein Verhalten war
ein wenig scheu, ein wenig zaghaft und ein wenig
selbstbewußt. Er sprach nicht viel, aber wenn man
ihn ansprach, war sein Gesicht immer von dem
Schimmer eines leisen Lächelns erhellt. Er legte
mir Zeichnungen vor, ließ mich aber allein und
kramte irgendwo im Atelier herum.
Ich sah mir die vorgelegten Blätter durch
und war anfangs entsetzt; aber es konnte
nicht lange dauern, bis ich über diese Klippe
von Erkenntnis hinweg war und Schiele als
das erkannte, was er, allen gegenteiligen
Anschauungen zum Trotz, immer gewesen ist:
ein wahrhaft großer Künstler von höchster Ei-
genart.
||
4.
Der Kreis Jener, die damals Schiele richtig ein-
schätzten, war nicht groß: Vor Allen Kunstschrift-
steller Arthur Roessler, der Schiele sehr förderte
und insbesondere in Deutschland bekanntmachte;
Professor Josef Hoffmann, Professor Kolo Moser,
sein (man könnte fast sagen) Freund Gustav
Klimt, der Industrielle Karl Reininghaus und
einige andere private Sammler. Die Liste
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Vom Tage meines ersten Zusammentreffens
mit Schiele stand ich vollständig im Bann
seiner Kunst. Aber nicht nur sie, auch seine
Persönlichkeit zog mich unwiderstehlich an. Wir
wurden Freunde und bleiben es bis zu sei-
nem Tode. Mit Ausnahmen jener Zeiträume,
in denen wir fern voneinander außerhalb
Wiens weilten, war ich mindestens einmal
wöchentlich bei Schiele und konnte so seinen
manchmal sprunghaften künstlerischen Aufstieg
verfolgen. Daß ich, soweit es meine bescheidenen
Mittel als vermögensloser Beamter gestatteten,
||
5.
auch Sammler wurde, ist selbstverständlich; jeden
Heller, den ich nicht für den Haushalt und die
Familie brauchte, trug ich zu Schiele.
Schiele war nicht nur als Künstler, sondern
auch als Mensch ungewöhnlich. Der Grundzug sei-
nes Wesens war der Ernst; aber nicht ein
düsterer, melancholischer, kopfhängerischer, sondern
der ruhige Ernst des von seiner geistigen
Aufgabe erfüllten Menschen. Die Dinge des All-
tags konnten ihn nicht anfechten; sein Blick
war immer, über sie hinweg, auf sein hohes
Ziel gerichtet. Dabei war er durchaus humo-
ristisch veranlagt und zum Scherzen geneigt;
seine Lustigkeit äußerte sich aber niemals
geräuschvoll; wenn sie hoch stieg, kulminierte
sin in einem kurzen, stoßweisen nicht sehr lau-
ten Gelächter. Wenn er z. B. seinen alten
Akademielehrer, Professor Griepenkerl in Stimme
und Haltung karikierte, konnte man sich
krumm lachen. Schiele war Griepenkerls „enfant
terrible“. Eines Tages sagte dieser in der
||
6.
Verzweiflung über den jungen Stürmer, der
sich über alle akademischen Kunstregeln hin-
wegsetzte: „Sagen Sie um Gotteswillen nie-
mandem, daß sie bei mir gelernt haben.“
Schieles heitere Ruhe war unerschütterlich; er
verlor sie nicht in den schwierigsten, widerwär-
tigsten Lagen seines Lebens. Im Gegenteil: je
unangenehmer es wurde, desto mehr steigerte sich
seine Heiterkeit. Ich habe ihn in den 8 Jahren un-
serer Bekanntschaft nicht ein einziges Mal zor-
nig oder auch nur ungehalten gesehen oder
bei ihm eine verdrossene Miene beobachtet. Er
wartete ruhig, bis irgendwoher die Hilfe kam
und sie kam immer, wenn auch in zwölfter
Stunde. Er war nicht nur ein bildender Künst-
ler, sondern auch ein Lebenskünstler im vollsten
Sinne des Wortes. Wenn ein Wiener Kunst-
kritiker anläßlich der 25. Wiederkehr von
Schieles Todestag schieb: „Sein kurzes Leben ist
tragisch umdüstert“, so gibt das einen ganz fal-
schen Begriff von Schieles Lebensführung. Tragisch
||
7.
ist nur, was man tragisch nimmt und Schiele
nahm nichts tragisch. Eine Tragödie in seinem
Leben war nur seine gerichtliche Belangung und
sein und seiner Gattin schneller, früher Tod.
Schieles Natur war kindlich (nicht kindisch). Kurz
bevor ich ihn kennen lernte, hatte ihn der Kunst-
sammler Karl Reininghaus besucht und sich so für
Schieles Zeichnungen begeistert, daß er eine größere
Zahl davon ankaufte und sofort honorierte. Schiele
zeigte mir nun, wie damals sein Rock vom
Körper abstand, weil er die dicke Brieftasche
nicht fassen konnte. Schiele ging im Sommer
dieses Jahres mit mehreren Freunden in die schöne
alte Stadt Krumau in Böhmen, die Heimatstadt
seiner Mutter, und als er zurückkehrte, paßte
der Rock wieder ausgezeichnet.
Schiele war ein guter, selbstloser und (eine
bei Künstlern seltene Eigenschaft) neidloser
Mensch. Ich sagte zu ihm eines Tages, ich würde
gern ein Bild des Malers Anton Faistauer er-
werben, was er dazu sage? Obwohl Schiele die
||
8.
Bescheidenheit meiner Mittel kannte und wußte,
daß der hiefür aufgewendete Betrag ihm entging,
antwortete er ohne Zögern: „Ja, einen Faistauer
muß man wohl haben.“ Schieles Freund und spä-
terer Schwager, Maler Anton Peschka arbeitete
jahrelang in Schieles Atelier mit dessen Material
und ließ auf Schieles Kosten bei dessen Schneider
arbeiten. Ich zweifle nicht, daß Schiele auch ande-
ren Freunden und Berufskollegen aushalf, soweit
er konnte; ich glaube auch, daß er seine Mutter,
obwohl sie eine Witwenpension bezog, materiell
unterstützen mußte. Damit komme ich zu einem
der schwächsten Kapitel in Egon Schieles Leben:
der Geldwirtschaft.
Ein Künstler von Bedeutung darf in Geld-
sachen nicht kleinlich sein, weil man von ihm
Großzügigkeit voraussetzt. Einen großen Künst-
ler als Pfennigfuchser kann ich mir nicht vor-
stellen, wohl aber als Verschwender. Bei Schiele
ging aber die Sorglosigkeit in Geldsachen so weit,
daß man von Leichtsinn sprechen dürfte. Als Bei-
||
9.
spiel: Ich saß mit Schiele und seinem Modell (und
Liebling) Vally Neuzil in Hietzing im Kaffeehause.
Während Schiele Karambol spielte, erzählte mir Vally,
daß Egon ganz blank sei und nicht wisse, wie er
am nächsten Tage sein Mittagessen bezahlen solle.
Ich war damals selber knapp, gab aber Schiele,
nachdem er sein Spiel beendet hatte, für den
dringendsten Bedarf 10 Kronen. Was tut nun unser
Egon? Er fährt, nachdem wir uns getrennt
hatten, mit Vally in’s Burgtheater, geht nach
Beendigung der Vorstellung mit ihr in’s Res-
taurant und erübrigt von den 10 Kronen ge-
rade noch so viel, um mit der Elektrischen nach
Hause fahren zu können.
Oder: Ich war mit Schiele und Vally in sei-
nem Atelier in der Hietzinger Hauptstraße.
Es läutet. Vally öffnet und es erscheint ein sehr
freundlicher älterer Herr, der sich als Steuerexe-
kutor vorstellte. Er sei vom Gericht beauftragt, hier
zu pfänden und Siegel anzulegen, wenn nicht die
eingeklagte Schuld beglichen würde. Sie betraf das
||
10.
Guthaben eines Wiener Spediteurs für die Verpackung
und den Transport von Schieles Bildern nach Deutsch-
land. Schiele war vom Gläubiger und vom Gerichte
wiederholt zur Zahlung aufgefordert worden, hatte
aber gerade (dieses „gerade“ war bei ihm zeitlich
recht ausgedehnt) kein Geld und steckte daher die
Zuschriften einfach in den Ofen. So war der schul-
dige Betrag durch allerlei Spesen auf die doppelte
Höhe angewachsen. Da nichts anderes zu machen
war, zahlte ich und begleitete den sehr befriedig-
ten Herrn Exekutor zur Wohnungstür. Als ich
in’s Atelier zurückkam, mochte ich wohl ein sehr
unglückliches Gesicht gemacht haben, denn Schiele
und Vally empfingen mich mit hellem Gelächter.
Schiele sah mich, wie immer freundlich lächelnd, an
und sagte: „Armer Herr B!“ (Er nannte mich
immer mit meinem Anfangsbuchstaben) Darauf
lachten sie abermals und zuletzt auch ich, womit
die Ordnung wieder hergestellt war.
Schiele machte öfter zur Sommerzeit mit Vally
oder mit Mutter und jüngerer Schwester kleine
||
11.
Reisen in die oesterreichischen Alpenländer bei denen,
meines Wissens, er die Kosten trug. Diese Reisen
waren meist von Haus aus finanziell schlecht fun-
diert und wurden oft so lange ausgedehnt, bis
man irgendwo festsaß und selbst das Geld zur
Rückreise fehlte. Da kam dann ein Brief: „Lieber
Herr B!“ u.s.w. Ich fluchte, aber ich zahlte, denn
sitzen konnte man ihn ja nicht lassen. Wenn
ich ihn dann nach seiner Rückkehr Vorwürfe mach-
te und fragte: „Was wäre denn gewesen, wenn ich
kein Geld gehabt hätte?“ sagte er: „Wenn’s sein
muß, haben Sie schon eines.“ Da hatte er nun wie-
der recht.
Schiele war auch leichtsinnig beim Versenden
seiner Zeichnungen. Dem Kunsthändler Goltz in
München schickte er dutzende von Zeichnungen,
die einfach (ohne Kartonhülle) in Packpapier ein-
gerollt waren und unverschlossen, bloß mit den
erforderlichen Postmarken beklebt, nicht eingeschrie-
ben zur Post gegeben wurden.
Von dem Tage, an dem ich begann, Schiele zu
||
13.
sammeln, war ich von einem Gefühle tiefer Dank-
barkeit gegen den Künstler durchdrungen, der
mir durch seine Werke so viel Glück beschert
hatte. Ich war daher immer bestrebt, nicht so billig
als möglich zu kaufen, sondern aus mir so
viel als möglich für den Künstler herauszuholen.
Schiele hat dies auch dankbar anerkannt, indem
er einmal zu Peschka (nicht in meiner Anwe-
senheit) sagte: „Der Herr B. ist mein bester Zahler.“
Dabei hatte Schiele sehr reiche Kunstfreunde, darunter
einen Döblinger Millionär, der einmal zu einem
Freunde sagte: „Der Benesch ist ein Narr, daß
er dem Schiele mehr zahlt, als er muß.“ Dieser
Millionär kaufte am billigsten und das kam so:
Ich konnte jeweils nur ein Blatt, besten falls zwei
Blätter auf einmal kaufen und Schiele bekam daher
von mir immer nur kleinere Beträge. Wenn
er nun mehr brauchte, rollte er ein Dutzend oder
mehr nicht aquarellierter Zeichnungen zusammen
und fuhr damit zu seinem Döblinger Millionär
hinaus. Der sah sich die Blätter ruhig, ohne Zeichen
||
14.
der Begeisterung an und sagte endlich: „Ja, ich brauche
die Sachen nicht; wenn Sie 10 Kronen für das Stück
wollen, können Sie sie hier lassen.“ Und Schiele
nahm die 120 Kronen für das Dutzend und fuhr
erleichtert nach Hause.
Psychologisch interessant war, daß Schiele, der meine
Opferwilligkeit anerkannte und schätzte, gerade mich,
den Mann der kleinen Mittel zeitweise mit den
Preisen steigerte. Ich widersprach nie und verlang-
samte nur notgedrungen das Tempo meiner Samm-
lertätigkeit. Schiele sagte einmal: „Wie schade
Herr B, daß sie kein Geld haben.“ Ja, das tat mir
am meisten leid um der Kunst und der Künst-
ler willen.
Es kam auch öfter vor, daß mir Schiele den
Ankauf eines Blattes verweigerte, auch wenn ich es
nicht von meinem Guthaben (Schiele war immer
bei mir in der Kreide) abziehen, sondern bar
bezahlen wollte. Warum? – ich weiß es nicht.
Er sagte einfach: „Das geb‘ ich nicht her“ und ich
gab mich zufrieden. Wenn ich aber dann dieses
||
15.
Blatt bei dem Döblinger Millionär (den ich öfter
besuchte) wiedersah, der es mit 10 Kronen be-
zahlt hatte, obwohl ich es nach der Damaligen, von
Schiele für mich festgesetzten Preislage mit 30 Kro-
nen honoriert hätte, dann konnte ich wohl fuchs-
teufelswild werden. Mein Zorn war aber im-
mer schon verraucht, wenn ich wieder zu Schiele
kam und ich machte ihm nie einen Vorwurf
daraus. Schließlich darf man einem Menschen,
der im guten Sinne Ungewöhnliches leistet, nicht
im übrigen mit dem Maßstabe des Spießbür-
gers messen.
Ich genoß aber nicht nur Schieles kleine Launen,
sondern auch seine Noblesse, denn er war eine
noble Natur. Wenn mein Guthaben schon höher
angestiegen war und durch Kunstwerke (nie-
mals bar) ausgeglichen wurde, versäumte
Schiele niemals, ein gutes Blatt als Draufgabe
zuzulegen.
Ich hatte mich im Laufe der Jahre oft an
Hilfs- Rettungs- und sonstigen Aktionen zugunsten
||
16.
Schieles beteiligt. Wenn eine gelungen war, quittier-
te dies Schiele anerkennend durch die Bemer-
kung: „Herr B. hat’s gemacht.“
Einmal – in einer Zeit größter Ebbe – bat mich
Schiele, zu Klimt zu gehen und ihm seine Nöte
vorzutragen. (Schiele selbst mochte es nicht tun.)
Klimt sei am besten in der Zeit zwischen 7 und 8
Uhr Morgens in der Meierei Tivoli am Grünen
Berge bei Schönbrunn zu treffen, wo wer täglich
sein Frühstück einnahm. Ich war am nächsten Tage
zur Stelle, traf Klimt, den ich schon persönlich
kannte, den Architekten Prutscher und noch
einen Herrn aus Künstlerkreisen, dessen Name
mir entfallen ist. Eben kam der Kellner mit
Klimts Frühstück, dabei ein gar nicht kleiner
Teller mit einem wahren Berge von Schlagobers.
Klimt blickte skeptisch auf den Teller und sagte:
„So wenig!“ ich bewunderte seit dieser Zeit Klimt
nicht nur wegen seiner Kunst, sondern auch we-
gen seines guten Magens. Ich brachte meine
Sache vor. Architekt Prutscher entwickelte sofort
||
17.
eine Reihe von Vorschlägen, von denen neun
Zehntel für Schiele nicht brauchbar waren.
Klimt sprach, wie gewöhnlich, nicht viel und sag-
te nur, er werde schon etwas machen. Tat-
sächlich empfahl er Schiele der kunstsinnigen
Familie des Großindustriellen August Lederer,
die sofort die Beziehungen zu Schiele auf-
nahm, viel von ihm kaufte und mit ihm in
dauernder Verbindung blieb. Schiele war
damit für längere Zeit aus dem Gröbsten
heraus.
Und nun komme ich zu einer ganz miß-
glückten Hilfsaktion, bei der der „gute“ On-
kel Czihaczek die Hauptrolle spielte.
Der Oberinspektor der Nordbahn, Ingenieur
Czihaczek (sein Vorname ist mir entfallen)
war der Gatte der Schwester von Egon Schieles
Vater. Das kinderlose Ehepaar lebte in Wien
in sehr guten Verhältnissen. Nach dem Tode von
Vater Schiele wurde Onkel Czihaczek Egons Vor-
mund und die Familie Schiele übersiedelte von
||
18.
Tulln nach Klosterneuburg, wo Egon das Gymnasium
besuchte. Er kam aber mit dem Studium nicht recht
vorwärts; der Drang nach der Kunst war über-
mächtig. Onkel Czihaczek wollte aber nicht, daß
Egon das unsichere Leben des Künstlers führe, er
sollte einen „nützlichen“ Beruf ergreifen, der ihm
sicheres Brot und Pensionsberechtigung brachte.
Endlich gab der Onkel seinen Widerstand auf;
Schiele kam 1906 an die Wiener Kunstakademie
und verließ sie 1909. Im Jahre 1910 sehen wir ihn
schon als selbständig schaffenden Künstler in sei-
nem Atelier in der Grünbergstraße. 31 tätig.
Von dieser Zeit an bracht er die Beziehungen
zum Onkel ab, sah aber die Tante öfter, die
eine heitere, lebenskluge Frau war und auf
Egons Seite stand.
Inwieweit Onkel Czihaczek Schiele unterstützte
und für ihn Opfer brachte, weiß ich nicht. Mir gegen-
über erwähnte Schiele nur, daß er öfters im Hau-
se des Onkels zu Tisch war und manchmal in die
Loge des Burgtheaters (Czihaczeks hatten ein Abonne-
||
19.
ment) mitgenommen wurde.
Im Frühjahre 1913 ging es Schiele sehr schlecht.
Er nährte sich ungenügend und ungleichmäßig,
was sich bald in seinem Aussehen zeigte. Auf einem
Selbstbildnisse aus diesem Jahre, einer Bleistift-
zeichnung, die für eine Schiele-Mappe reproduziert
wurde, ist dies deutlich sichtbar. Wir hielten da-
mals zu zweit eine Notstands-Sitzung ab und ich
verfiel endlich, nach Prüfung aller Hilfsquellen,
auf Onkel Czihaczek. Schiele lachte und meinte, da
werde ich kein Glück haben. Ich wollte es dennoch
versuchen.
Ich suchte den damals schon pensionierten On-
kel Czihaczek in seinem Heim in der Leopold-
stadt auf. Ich wurde (nur von ihm) höflich, aber
sehr kühl empfangen. Der Zweck meines Besuches
war ihm noch nicht bekannt. Ich will mein Urteil
über ihn in wenige Worte zusammenfassen:
kalt, verschlossen, selbstgefällig, pedantisch, hinterhäl-
tig – wenig intelligent.
Ich brachte meine Sache vor, verwies zunächst auf
||
20.
Schieles zweifellose Künstlerschaft, die Großes versprach,
schilderte seine augenblickliche Notlage und bat end-
lich um Hilfe. Der Onkel hörte mich ruhig, mit hartem,
abweisendem Gesichte an und sagte endlich: „Das
ist ausgeschlossen.“
Ich legte noch einmal, kräftiger los und betonte,
daß Schiele derzeit nicht in der Lage sei, sich aus-
reichend zu ernähren, und oft dem Hunger nicht
ferne stehe. Die ruhige, kalte Antwort lautete:
„So arg wird es wohl nicht sein.“ Auch ein dritter
Versuch, das steinerne Herz zu rühren, erzielte nur
die Antwort: „Es ist ausgeschlossen!“. Ich erkannte
die Lage als hoffnungslos und empfahl mich mit
stummer Verbeugung, die ebenso erwidert
wurde.
Als ich Schiele hierüber berichtete, meinte er:
„Was habe ich Ihnen gesagt!“ Dann lächelte er
mich freundlich an und sagte: „Armer Herr B!“
In der Schiele-Literatur und in den Zei-
tungsartikeln, die besonders nach Schieles Tode
erschienen, war wiederholt darauf verwiesen,
||
21.
daß ihn sein Onkel (Czihaczek) gefördert und unter-
stützt habe. Nun, gefördert hat er ihn wohl nie,
denn er hat seinem Bestreben, Künstler zu wer-
den, immer den schärfsten Widerstand entgegen-
gesetzt; und unterstützt hat er ihn vielleicht wäh-
rend der Dauer der Vormundschaft, nach Schieles
selbständigem Auftreten aber gewiß nicht. Er
kümmerte sich einfach nicht mehr um ihn und ver-
hielt sich durchaus ablehnend.
Man muß Onkel Czihaczek indes zugute halten,
daß er für Schieles Kunst nicht das mindeste Ver-
ständnis hatte, obwohl ihm hiezu reichlich Gelegenheit
geboten war, denn Schieles Talent zeigte sich sehr
früh. Schon als kleiner Knabe beobachtete er am
Bahnhofe in Tulln (N.Ö. [Niederösterreich]) wo sein Vater Vorstand
war, mit großem Interesse den Zugverkehr
und die Verschiebungen und begann zu zeichnen.
Tante Czihaczek, die ich nach ihres Gatten Tode öfter
besuchte, zeigte mir einmal einen schmalen Strei-
fen weißen Papieres, auf den der kleine Egon
einen durchfahrenden Schnellzug gezeichnet hatte.
||
22.
Es war die überzeugendste Darstellung dieser
Impression, die ich je gesehen habe. Die kleinen
Räder waren wie mit dem Zirkel gezogen;
die Radspeichen, die nur an der Nabe sichtbar
waren und der zerflatternde Rauch aus der
Lokomotive ließen die große Geschwindigkeit
erkennen. Erst nach Schieles großer Ausstellung
in der Sezession im März 1918, als sein Name
in Aller Munde war und die Zeitungen
lobende Artikel brachten, wurde der Onkel auf-
merksam. Aber erst nach Schieles Tode wurde
er der lauteste Verkünder des Ruhmes seines
Neffen und war sogar stolz auf ihn.
Wenn Schieles Persönlichkeit ehrlich geschildert
werden soll, darf man an den Schwächen seines
Charakters nicht vorübergehen.
Schiele war, wie sein großer Kollege Klimt,
Erotiker. Er zeichnete und malte, was er sah
und kannte kein Feigenblatt. Er war infolge-
dessen in sexuellen Dingen von großer Freiheit.
Bei den Berufsmodellen mochte dies angehen,
||
23.
nicht aber bei Kindern, nach denen er viel
und gerne Akt zeichnete. Er nahm hiebei auf die
Unverdorbenheit der Kinder (die allerdings
oft nicht mehr vorhanden war) keine Rücksicht.
Es geschah dies gewiß nicht aus Schlechtigkeit, son-
dern aus Gedankenlosigkeit und Sorglosigkeit. Er
hat sich an den Kindern nie schwerer vergangen.
Immerhin führte diese Tatsache zur Katastrophe
von Neulengbach, von der später noch die
Rede sein soll.
Ein zweiter Vorwurf, den Schiele selbst seine
Freunde machen müssen, ist der der unsoliden
Arbeit bei seinen Oelbildern. Er legte auf die
Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit seiner Oelmalerei
keinen Wert und das darf ein Künstler nicht;
nicht nur aus Achtung vor der Kunst und dem
eigenen Werke, sondern auch aus Rücksicht auf
den Käufer. Er arbeitete oft mit minder-
wertigen, unzulänglichen Malmitteln, wenn
das Geld für Besseres nicht ausreichte. Im
Eifer der Arbeit mischte er mitunter die Farbe
||
24.
so oberflächlich mit dem Malmittel, daß sich die-
ses von der Farbe absetzte. Es sind daher viele
seiner Oelbilder heute schon Ruinen, die zu
ihrer Erhaltung sorgfältiger Pflege bedürfen.
Die Würdigung von Schieles Kunst ist Sache
des Kunsthistorikers, der ich nicht bin. Wenn ich
dennoch darüber spreche, so gebe ich damit nur
ein ganz allgemeines, rein persönliches Urteil ab.
Schiele war ein universeller Künstler größten
Stils. Seine Kunst ist im höchsten Maße eigenartig; es
besteht nichts auch nur Ähnliches neben ihr. Was
er anpackte, war Kunst, ob es nun Zeichnen, Ma-
lerei, Plastik oder Kunstgewerbe war; etwa
ein Monogramm zu einem Petschaft oder ein
Entwurf zu einem Zierpolster. Ließ er sich doch
seine Anzüge (auch hinsichtlich des Schnittes) nach
seinen Angaben herstellen und er sah darin,
trotz kleiner Absonderlichkeiten, prächtig aus.
Was Schiele uns in Form und Farbe an
Schönheit brachte, war vor ihm noch nicht erlebt
worden. Für seine Zeichenkunst gibt es nur einen
||
25.
Ausdruck: phänomenal. Die Sicherheit seiner
Hand war fast unfehlbar. Beim Zeichnen saß er
wohl öfter auf einem niedrigen Schemel, das Reiß-
brett mit dem Zeichenblatte auf den Knieen [!],
die zeichnende rechte Hand auf die Unterlage ge-
stützt; aber er konnte auch anders. Ich sah ihn
zeichnen, vor dem Modelle stehend, den rechten Fuß
auf einem niedrigen Schemel aufgesetzt. Das Reiß-
brett stützte er auf das rechte Knie und hielt es
mit der Linken am oberen Rande fest. Nun
setzte er den Bleistift mit freistehender Hand
senkrecht auf das Blatt und zog, sozusagen aus
dem Schultergelenke heraus, seine Linien. Und
das saß alles richtig und fest. Kam er ein-
mal daneben, was äußerst selten der Fall
war, so warf er das Blatt weg. Er kannte
keinen Radiergummi.
Schiele schuf seine Zeichnungen nur vor der
Natur. Sie waren im wesentlichen Konturzeich-
nungen, die erst durch die Farbe höhere Plastik
erhielten. Die Kolorierung erfolgte immer
||
26.
ohne Modell aus dem Gedächtnisse, ein Beweis, daß
Schiele die Kenntnis des menschlichen Körpers bis
in’s [!] kleinste besaß.
Im Jahre 1917 fing Schiele an bei seinen Zeich-
nungen in der Farbe etwas roh zu werden.
Die zarten Töne der menschlichen Haut wurden
derb, so daß die Akte manchmal ganz scheckig
aussahen. Als ich ihn einmal diesbezüglich aus-
holte, meinte er, die Farbe wäre gar nicht
nötig, man könne alles mit dem Stifte aus-
drücken. Tatsächlich kolorierte er später seine
Zeichnungen nicht mehr und wendete zur Er-
höhung ihrer Plastik einen breiten, weichen,
sehr lockeren, schummerigen Strich an, der die
Farbe nicht vermissen ließ und Schieles Gestal-
tungskraft in neuem Lichte zeigte.
Im Jahre 1917 und anfangs 1918 entstand eine
große Menge von Aktzeichnungen, die ledig-
lich Schieles Virtuosität zeigten, geistig aber
leer und inhaltslos, also wenig erfreulich wa-
ren. Ich glaube, darin den nachteiligen Einfluß
||
27.
seiner Frau zu sehen, die ihn wegen der höheren
Kosten des ehelichen Haushaltes zu größerer Tätig-
keit anspornte. Schiele war nie faul, aber er
folgte bei seinem Schaffen immer nur dem inne-
ren künstlerischen Triebe, niemals der Zweckmä-
ßigkeit (Verkaufsmöglichkeit).
Nach meinem persönlichen Empfinden stand
Schieles Kunst in den Jahren 1910, 1911 und 1912
auf dem Höhepunkte. Das Liebste von Allem
sind mir seine Zeichnungen aus dem Jahre 1910.
Die Interieur-Zeichnungen jedoch, die Schiele
im Jahre 1917 als Militärpflichtiger in einem
ärarischen Verpflegsmagazin schuf, gehören,
glaube ich, zum Höchsten, was Zeichenkunst
jemals geleistet hat.
Schiele war auch Sammler, aber er sammel-
te nicht Wertvolles, sondern kleine Dinge, Nich-
tigkeiten, die durch Form und Farbe seinem
künstlerischen Empfinden entsprachen: Kleines
bemaltes Kinderspielzeug, kleine bäuerliche
Holzplastiken und Hinterglasmalereien, bunte
||
28.
Stickereien und Kopftücher und Ähnliches. Seine
Vitrine sah aber interessanter aus, als die man-
ches reichen Kunstfreundes.
Im Somme 1911 übersiedelte Schiele von
der Grünbergstraße im 12. Bezirke nach Neu-
lengbach (N.Ö.). Er begründete diesen Schritt
damit, daß er auf dem Lande viel freier
und ungehinderter schaffen könne. Er bewohn-
te dort ein am Südabhange des Buchberges
liegendes, aus zwei sehr hellen, geräumigen
Zimmern, Küche und Vorraum bestehendes
Einfamilienhaus mit hübschem Garten. Die
Aussicht von seinen Zimmern war herrlich:
Links die Ausläufer des Wienerwaldes; gerade-
aus, auf bewaldetem Hügel, Schloß Neuleng-
bach; rechts der Haspelwald und der Beginn
des Tullnerfeldes. Schiele war dort meist allein.
Vally blieb in Wien, besuchte ihn aber oft. Die
Zeit, die Schiele in Neulengbach verbrachte,
dürfte die glücklichste seines Lebens gewesen
sein, was schon aus der reichen, hochwertigen
||
29.
künstlerischen Produktion aus jener Zeit zu ent-
nehmen ist.
Dann kam das Verhängnis.
Ich hatte Schiele immer gewarnt, beim Umgan-
ge mit seinen Kindermodellen vorsichtig zu sein
und nichts ohne Einverständnis der Eltern
zu unternehmen. Er gab mir hierüber beru-
higende Erklärungen.
An einem Märzabend des Jahres 1912
kam Mutter Schiele mit ihrer jüngeren Tochter
Gertrud in größter Verzweiflung in meine
Wohnung und teilte mir mit, daß Egon gestern
in Neulengbach verhaftet worden sei. Man be-
schuldige ihn der „Unsittlichkeit“ und „Entführung“.
Ich ahnte sofort den Zusammenhang. Herr
Karl Reininghaus, der gleichzeitig verständigt
worden war, stellte Rechtsschutz kostenlos bei.
Ich fuhr am nächsten Tage nach Neulengbach
und durfte Schiele sprechen. Ich tröstete ihn und
sprach ihm Mut zu. Er war sehr gedrückt, aber
der kindlich heitere Ausdruck in seinem Gesichte
||
30.
blieb unverändert. Er blieb ungefähr 14 Tage
im Gewahrsam des Bezirksgerichtes Neulengbach
und ich besuchte ihn dort noch zweimal. Dann
wurde er nach St. Pölten gebracht, wo das Kreis-
gericht das Verfahren gegen ihn durchführte.
Der Vorwurf der „Unsittlichkeit“ war durch
folgenden Tatbestand gegeben: Schiele duldete
es in seiner Gutmütigkeit, daß nach Beendi-
gung der Arbeit nach Kindermodellen oft
ganze Scharen von kleinen Knaben und
Mädchen, die Schulkameraden und Kame-
radinnen der Modelle, in das Arbeitszim-
mer kamen und sich dort herumtummelten.
Schiele hatte nun ein wundervolles farbiges
Blatt, ein ganz junges, nur am Oberkörper
bekleidetes Mädchen darstellend, mit Haftnägeln
an der Wand befestigt. Der Körper war so
dargestellt, wie Gott ihn erschaffen. Die nicht
mehr unschuldigen unter den Kindern tuschel-
ten über die Nudität, erzählten davon und
so kam es zur Anzeige.
||
31.
Das schöne Blatt wurde später über Gerichts-
beschluß vernichtet. – Sancta simplicitas.
Nun die „Entführung“, wie sie mir darge-
stellt wurde:
In Neulengbach lebte damals ein Marine-
beamter mit Frau und etwa 15 jähriger Tochter,
die in den hübschen Schiele verliebt sein mochte,
denn sie lief ihm unausgesetzt nach. Schiele
verhielt sich durchaus gleichgültig. Eines Tages
stand Schiele mit Vally am Bahnsteige der
Haltestelle Neulengbach Markt, um nach Wien
zu fahren. Da erschien das Mädchen, erklärte,
es wolle nicht mehr bei seinen Eltern blei-
ben, es wolle zur Großmutter nach Wien
und bat, mitgenommen zu werden. Da die
Kleine kein Geld hatte, bezahlte Schiele die
Fahrkarte und sie fuhren zusammen nach Wien.
Als sie daselbst eintrafen, war es Abend ge-
worden. Das Mädchen wollte nicht so spät
zur Großmutter kommen, daher wurde es
in’s [!] Hotel mitgenommen, wo alle drei über-
||
32.
nachteten; Schiele im abgesonderten Zimmer.
Am nächsten Tage wurde das Mädchen zur
Großmutter gebracht, aber noch am selben Tage
von den Eltern heimgeholt. Schiele hatte also
ihre Flucht aus dem Elternhause unterstützt,
was als „Entführung“ qualifiziert wurde. Die
Anklage wegen Entführung soll bei der Ver-
handlung des Kreisgerichtes St. Pölten gegen
Schiele fallengelassen worden sein.
Die Verhandlung fand, meines Erinnerns,
ungefähr eine Woche nach Schieles Überstellung
nach St. Pölten statt. Welches Ergebnis sie hatte,
weiß ich nicht. Ich habe Schiele befragt, aber
er wollte darüber nicht sprechen und ich
drang nicht auf Antwort. Irgendwer aus
Schieles Umgebung – ich weiß nicht mehr, wer
es war – sagte mir, er wäre nur wegen
Unsittlichkeit zu drei Tagen Arrestes verur-
teilt worden. Jedenfalls wurde er einige
Tage nach der Verhandlung aus der Haft
entlassen und diese Tatsache beweist, daß keiner-
||
33.
lei schweres Verschulden vorlag.
Schieles Mutter, Vally und ich holten Schiele
aus St. Pölten ab. Die Frauen warteten auf dem
Bahnhofe und ich begab mich allein nach dem
Kreisgerichte. Als ich mit Schiele das Gebäude ver-
ließ, atmete er tief auf und sein Gesicht ließ
das Glück über die wiedererlangte Freiheit
erkennen.
Man gestattete, daß Schiele während seiner
Haft mit Arbeitsmaterial versehen wurde. Er
brachte auch etwa ein Dutzend farbiger Zeich-
nungen aus Neulengbach und St. Pölten heim.
Drei in Neulengbach entstandene, bisher nicht
reproduzierte farbige Blätter besitze ich. Sie
sind interessant genug, um besonders beschrie-
ben zu werden:
Das erste zeigt Schiele, auf der Pritsche
liegend, mit seinem rotbraunen Mantel
zugedeckt. Das Blatt trägt ober der Signie-
rung und Datierung mit dem Tage des Ent-
stehens die Inschrift: „Den Künstler hemmen ist
||
34.
ein Verbrechen, es heißt keimendes Leben morden.“
Das zweite Blatt zeigt Schiele, vorgebeugt sit-
zend, mit umgehängtem Mantel, der aber grau
getönt ist. Sein Gesicht ist von einem grinsenden,
wie verzweifeltem Lachen überzogen, die Inschrift
lautet: „Gefangener!“.
Das dritte Blatt gibt einen Blick von der Prit-
sche nach der Tür ober der sich ein großes, schwer
vergittertes Oberlichtfenster befindet. Durch dieses
sieht man auf ein paar Dachfirste und Rauch-
fänge sowie auf zwei junge, noch unbelaubte
Bäume, auf denen einige Meisen sitzen. Es ist
eine liebliche kleine Frühlingslandschaft voll
Sehnsucht nach der Freiheit. Das Blatt zeigt die
Inschrift: „Die Tür in das Offene.“ Beide letzt-
genannte Blätter sind ebenfalls signiert und
voll datiert.
Ich besitze ferner eine kleine Plastik, die
aus Brot geknetet und modelliert ist. Sie stellt
das Porträt eines St. Pöltener Häftlings dar
und hat nur Nußgröße, ist aber von ungewöhnlicher
||
35.
Charakteristik – ein wahres Meisterstück im Kleinen.
Schiele betrat Neulengbach, wo er so glücklich
und erfolgreich gewesen war, nie wieder. Auf
seine Bitte leitete ich seine Übersiedlung nach
Wien in die Wege, wo er zunächst bei seiner
Mutter in Ober-Hetzendorf wohnte. Da er dort
keine Arbeitsmöglichkeit hatte, ging er als Gast
in das Atelier eines Maler-Freundes, der sich
Mime van Osen nannte; ein genial veranlag-
ter Mann, der seinerzeit als Theatermaler am
deutschen Theater in Prag tätig gewesen war,
aber infolge seiner ungezügelten Lebensweise
nirgends Fuß fassen konnte. Leider wurde der
gutgläubige Schiele von diesem Mann schwer
getäuscht und materiell geschädigt.
Als sich Schiele finanziell etwas erholt hatte,
bezog er ein eigenes Atelier in der Hietzinger
Hauptstraße Nr 101, wo er bis zum Beginn des
Jahres 1918 verblieb. Im Jahre 1913 entspann sich
dort ein zartes Verhältnis zu der jüngeren
Tochter Edith des kleinen Eisenindustriellen
||
36.
Johann Heinrich Harms der gegenüber im eige-
nen Hause, Hietzinger Hauptstraße Nr 114 wohnte.
Im Jahre 1915 wurde geheiratet.
Die Ehe lief gut an, nur war Frau Schiele,
eine mondäne, mittelgroße, sehr bewegliche Blon-
dine stark eifersüchtig, was aber an Schieles
heiterem Gleichmute wirkungslos abprallte. So
durfte er anfangs nur nach ihr Akt zeichnen.
Als sie aber anfing etwas füllig zu werden,
Schiele aber schlanke Figuren künstlerisch bevor-
zugte, mußte sie schließlich auch andere Modelle
dulden; aber sie paßte scharf auf.
Im Jahre 1915, dem zweiten des ersten Welt-
krieges wurde Schiele kurz vor seiner Eheschließung
für den Militärdienst gemustert. Ich war wie
vor den Kopf geschlagen, als ich von ihm eine
Karte erhielt, worauf stand:
„geeignet“, am 21. Juni nach Prag einrücken!
Beste Grüße Egon Schiele.“
Also der zarte Schiele mit dem femininen Knochen-
bau und dem zwar gesunden aber schwach ent-
||
37.
wickelten Kinderherzen (ärztlich festgestellt) war
kriegsdiensttauglich.
Schiele kam nach der Einrückung zur Abrich-
tung nach Neuhaus in Böhmen. Er schrieb mir,
daß die ersten 14 Tage seiner dortigen Tätig-
keit die schlimmsten seines Lebens gewesen seien.
Man mochte wohl bald erkannt haben, daß
Schiele kein Frontsoldat war. Er kam nach Wien
zurück und wurde einem Wachkommando auf
der Sofienalpe zugeteilt. Bald darauf wurde
er dem Gefangenenlager in Mühling bei
Scheibbs in Niederoesterreich als Schreibkraft zu-
gewiesen, wo er viele Porträts von oesterrei-
chischen Offizieren und russischen Gefangenen zeich-
nete. Später war er in Wien in einem ära-
rischen Verpflegsmagazin beschäftigt und wurde
nach einigen Monaten dieser Tätigkeit dem
Heeresmuseum im Wiener Arsenal zugewiesen.
Dort hatte er viel übrige Zeit und konnte
sich wieder seinen künstlerischen Aufgaben widmen.
Da Schiele die Absicht hatte, Bilder großen
||
38.
Formates zu malen (eine Studie zu einem „Heiligen
Abendmahl“ ist vorhanden) wozu sein Atelier in
der Hietzinger Hauptstraße nicht hoch genug
war, übersiedelte er zu Beginn des Jahres
1918 in ein ehemaliges Bildhaueratelier in
Hietzing, Wattmanngasse Nr 6, in dem sich
ein etwa 7 Meter hoher, ferner ein kleinerer Ar-
beitsraum und ein Wohnzimmer befanden.
Dort sah ich noch die Vorbereitungen zu dem ob-
erwähnten großen Bilde: Den Blendrahmen
und die Leinwand; zur Ausführung sollte es
nicht mehr kommen.
Schiele hatte im Laufe der Jahre nicht
nur in Oesterreich und Deutschland, sondern auch
im Auslande ausgestellt. Seine erste Wiener
Ausstellung hatte er im Jahre 1911 in der Ga-
lerie des Kunsthändlers Miethke in der Do-
rotheergasse. Ich traf ihn einmal in der inneren
Stadt auf dem Wege dahin. Er wollte sich wie
er sagte, „den ersten Tausender holen“. Er
brachte aber keinen Tausender heim, ja nicht
||
39.
einmal einen Hunderter. Das war aber nicht seine
Schuld, sondern die der Wiener, die ihn noch
nicht verstanden. Es wären in dieser Kollektiv-
Ausstellung viele schöne Dinge wohlfeil zu haben
gewesen.
Ein Jahr später beteiligte sich Schiele als Gast
an einer Ausstellung des Künstlerbundes
„Hagen“ in der Zedlitzgasse. Dort sah man
nebst anderen trefflichen Arbeiten sein großes
Bild „Die Eremiten“, das allgemeine Beach-
tung fand und die Aufmerksamkeit auf den
Künstler lenkte.
Im Jahre 1914 lud Karl Reininghaus die
modernen jungen Künstler zu einem Wett-
bewerbe ein, an dem sie sich mit je einem
Werke beteiligen konnten. Es war ein erster
Preis von 2000 Kronen und ein zweiter von
1000 Kronen ausgesetzt. Schiele tat mit. Obwohl
wir ihm rieten, sein großes, vom Kunstsamm-
ler Franz Hauer erworbenes Bild „Die Auf-
erstehung“, das in Wien noch nicht ausgestellt
||
40.
worden war, zu entlehnen und einzureichen,
malte er ein neues Bild, das aber im Grunde
nur ein Torso blieb, weil er mit der Kom-
position nicht zu Rande kam und nur die
beiden Hauptfiguren malte. Er fiel durch,
obwohl er, nach meiner Meinung, der genialste
der ausstellenden Künstler war. Den ersten
Preis errang Anton Faistauer für einen weib-
lichen Akt, den zweiten Paris Gütersloh für
eine Madonna. Das Urteil, das nur auf
Grund der eingereichten Bilder gefällt wer-
den konnte, war durchaus gerecht.
Endlich schlug Egon Schieles große Stunde.
Seine Ausstellung in der Secession im März
1918 brachte ihm die langverdiente allge-
meine Anerkennung und damit auch reichen
materiellen Erfolg. Er war der Existenzsor-
gen ledig.
Ich besuchte Schiele kurz nach dem Zusammen-
bruche der Monarchie. Er war schon lange, im
Gegensatze zu mir, der Ansicht gewesen, daß
||
41.
die Entente siegen würde und behielt Recht.
Er sagte mir damals: „Sehen Sie, Herr B.,
was hab‘ ich Ihnen gesagt.“
Etwa Mitte Oktober sah ich Schiele zum letzten-
male. Er zeigte mir eine Reihe neuer Blätter,
darunter farbige Darstellungen von Gruppen
von Zierkrügen. Eines der schönsten dieser
Blätter überließ er mir auf meine schüchterne
Frage zu dem wahren Freundschaftspreise von
50 Kronen – ein Beispiel seiner Güte und
Dankbarkeit. Er bekam damals für ein sol-
ches Blatt 200 bis 300 Kronen. Als ich ihm
gerührt dankte, meinte er begütigend:
„Ich verliere bei Ihrem Blatte nur drei
Nachtmahle.“ Er pflegte nämlich mit seiner
Frau fast täglich im Restaurant Ottakringer-
Bräu am Hietzinger Platze das Abendessen
einzunehmen. Dabei ließen sie sich nichts
abgehen, zahlten aber im Durchschnitte
50 Kronen pro Abend. Damals begann schon
die Inflation.
||
42.
Ich schied von Schiele mit einem Händedrucke.
Wir wußten nicht, daß es der letzte war.
Am Abend des 28. Oktober 1918 erhielt ich
von Schiele ein Telegramm: „Edith Schiele
nicht mehr“. Ich war tief bestürzt, denn ich
wußte nichts von ihrer Erkrankung. Frau Edith
Schiele war nach achttägigem Krankenlager der
Spanischen Grippe erlegen. Mit ihr starb keimend-
des Leben. Am nächsten Nachmittage war ich in
der Wattmanngasse und fand Frau Schiele auf
dem Totenbette. Schiele war nicht anwesend;
man sagte mir, er sei auch erkrankt und
liege in der Wohnung seiner Schwiegermutter,
Hietzinger Hauptstraße Nr 114. Ich wollte ihn am
nächsten Tage besuchen, erkrankte aber in-
zwischen selbst. Am 1. November um 8 Uhr Mor-
gens stand die Schwester von Schieles Schwager
Peschka vor mir und sagte: „Herr Benesch,
der Egon Schiele ist gestorben.“ Mir war, als
stürze der Himmel ein und ich brauchte lange,
bis ich das Ereignis in ganzer Bedeutung
||
43.
erfaßte. Als am 30. Oktober die Leiche der Frau
Edith auf der Fahrt auf den St. Veiter Friedhofe
das Vaterhaus passierte, kämpfte dort ihr Gatte
Egon mit dem Tode. Am 31. Oktober starb er nach
dreitägigem Krankenlager. Sein schwaches Herz
hatte nicht länger standgehalten. Er litt sehr
in diesen Tagen, aber der Tod war sanft und
ruhig. Die linke Hand unter den Kopf gelegt,
schlummerte er hinüber. Er hatte seine Frau
am Tage vor ihrem Tode noch einmal gezeichnet.
Das Bild ist von erschütternder Wirkung. Deut-
lich liegen schon die Schatten des Todes auf
dem jungen Angesichte.
Schiele hatte eine Ahnung von seinem Ende.
Noch vor der Erkrankung seiner Frau sagte
er zu seinem Schwager Peschka: „Mir steht et-
was Großes bevor; ich weiß nur nicht, was
es ist.“
Sonntag den 3. November fand seine Beer-
digung statt. Er wurde, wie seine Gattin, im
Grabe von deren Vater auf dem St. Veiter
||
44.
Friedhofe beigesetzt. Ich konnte wegen meiner
Erkrankung an der Leichenfeier nicht teilnehmen,
wohl aber mein Sohn. Einige Tage später wohnte
ich der Seelenmesse des Verewigten bei.
Damit war unter Egon Schieles Leben
und unsere Freundschaft der Schlußstrich gezogen.
Wenige Jahre später wurden die Leichen
von Egon und Edith Schiele in ein von der
Gemeinde Wien auf demselben Friedhofe ge-
widmetes Ehrengrab umgebettet. Im Jahre
1929 wurde auf Veranlassung der „Gesell-
schaft zur Förderung moderner Kunst“ in
Wien auf diesem Grabe ein vom Bildhauer
Benjamin Ferenczy geschaffenes Grabmal
aufgestellt, dessen Kosten von Schieles Freun-
den und Verehrern bestritten worden waren.
Wien, im November 1943.
Heinrich Benesch.
(Nachtrag nächste Seite.)
||
45.
Nachtrag.
Ehe ich Egon Schiele kennen lernte, hatte ich schon einige
Bilder junger Künstler erworben. Es waren die Ma-
ler Hugo Baar, Otto Barth, Friedrich Beck, Adolf
Groß * und Hans Katzler. Sie waren durchaus tüchtige
Impressionisten und mit Ausnahme Katzlers (der nur
Autodidakt, dennoch aber ein sehr feiner Künstler ist)
Mitglieder der Künstlervereinigung „Jungbund“,
die später im Künstlerbunde „Hagen“ aufging.
Als Schiele mich das erstemal besuchte, und
meine kleine Galerie betrachtete, fragte ich ihn:
„Nun, was sagen Sie zu meinen Bildern?“ Er
erwiderte ruhig und freundlich: „Es sind einige
darunter, die nicht ganz schlecht sind.“ (Der Ton
lag auf dem Worte „ganz“).
Dieser Ausspruch, der mich sehr erheiterte,
denn ich war mir des künstlerischen Wertes der
Bilder wohl bewußt, beweist in erster Linie Schie-
les große Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Er zeigt aber
auch, wie ferne Schiele in seinen künstlerischen Anschau-
*Gustav Jahn
||
46.
ungen jenen Künstlern stand, die nicht vollstän-
dig Neues, Großes brachten. Er wollte gewiß nicht
die Künstler schmähen und beabsichtigte auch nicht,
mir die Bilder mies zu machen – er war nur
ehrlich ohne jeden Rückhalt. Sein vernichtendes Ur-
teil hat mich auch nicht beirrt; die Bilder sind
mir heute so lieb wie damals, als ich sie erwarb.
Trotzdem – mit den Jungen, die was kön-
nen, gehe ich heute noch durch dick und dünn,
denn die Jugend des Herzens habe ich mir
bewahrt.
B.
Mein Weg mit Egon Schiele.
Im Jahre 1908 begegnete ich in einer Ausstellung
der Klosterneuburger Künstler im Marmorsaal des
dortigen Stiftes den Werken eines jungen Künstlers,
die Aufmerksamkeit erregten. Es waren kleine, haupt-
sächlich landschaftliche Oelstudien, die flott und sicher
gemalt waren (vielleicht mit dem Pinselstiele kräf-
tig und zielbewußt in die nasse Farbe hineingear-
beitet) und jedenfalls Eigenart verrieten. Das
war Egon Schiele.
Im folgenden Jahre sah ich in der Ausstellung
„Kunstschau“, die in einem provisorischen Baue
auf den Gründen des Wiener Eislaufvereins gezeigt
wurde zwei Oelbilder, die ungemein stark an
Klimt erinnerten. sie stellten ein junges Mäd-
chen in Hut und Mantel und ein Bildnis des Ma-
lers Anton Peschka dar. Mein Urteil war: „Eine
schwache Nachahmung von Klimt.“ Das war aber-
mals Egon Schiele.
Im Herbste des Jahres 1910 endlich stand ich
wieder im Klosterneuburger Stiftssaale vor einem
||
2.
Oelbilde, das als Dekoratives Panneau bezeichnet war;
etwa 30 cm breit und etwas über ein Meter hoch.
Es stellte nichts dar, als eine voll erblühte Son-
nenblume, aber die war gemalt, daß ich so-
fort in flammender Begeisterung aufging. Was
der Mann für Farben brachte und wie er sie
mischte und zu einem einzig schönen Akkorde
nebeneinander stellte, das hatte man bisher
nicht gesehen. Auch hier lugte noch ein wenig
Klimt durch die Maschen der Leinwand, aber
die Hauptsache war doch: Neue, vielversprechende
Eigenart. Und das war nun auch der gleich einem
aufsteigenden Gestirn in Erscheinung tretende
Egon Schiele.
Ich beschloß sofort, den Künstler persönlich kennen
zu lernen und schrieb ihm in sein Atelier in der
Grünbergstraße. Nach wenigen Tagen erhielt ich
eine Postkarte mit dem Datumstempel 22. XI. 1910 [1],
auf der in eigenartiger, von Schiele angewen-
deter Blockschrift stand:
„Am Freitag Nachmittags, wenn lieb, ab 2h.
Bestens
Egon Schiele.“
||
3.
Dieser Freitag wurde für mich zum Geburtstage.
Ich kam und fand einen schlanken jungen Mann
von mehr als mittlerer Größe und aufrechter,
ungezierter Haltung. Blasses, aber nicht krank-
haftes, schmales Gesicht, große dunkle Augen
und üppiges, halblanges, dunkelbraunes, zwang-
los emporstehendes Haar. Sein Verhalten war
ein wenig scheu, ein wenig zaghaft und ein wenig
selbstbewußt. Er sprach nicht viel, aber wenn man
ihn ansprach, war sein Gesicht immer von dem
Schimmer eines leisen Lächelns erhellt. Er legte
mir Zeichnungen vor, ließ mich aber allein und
kramte irgendwo im Atelier herum.
Ich sah mir die vorgelegten Blätter durch
und war anfangs entsetzt; aber es konnte
nicht lange dauern, bis ich über diese Klippe
von Erkenntnis hinweg war und Schiele als
das erkannte, was er, allen gegenteiligen
Anschauungen zum Trotz, immer gewesen ist:
ein wahrhaft großer Künstler von höchster Ei-
genart.
||
4.
Der Kreis Jener, die damals Schiele richtig ein-
schätzten, war nicht groß: Vor Allen Kunstschrift-
steller Arthur Roessler, der Schiele sehr förderte
und insbesondere in Deutschland bekanntmachte;
Professor Josef Hoffmann, Professor Kolo Moser,
sein (man könnte fast sagen) Freund Gustav
Klimt, der Industrielle Karl Reininghaus und
einige andere private Sammler. Die Liste
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Vom Tage meines ersten Zusammentreffens
mit Schiele stand ich vollständig im Bann
seiner Kunst. Aber nicht nur sie, auch seine
Persönlichkeit zog mich unwiderstehlich an. Wir
wurden Freunde und bleiben es bis zu sei-
nem Tode. Mit Ausnahmen jener Zeiträume,
in denen wir fern voneinander außerhalb
Wiens weilten, war ich mindestens einmal
wöchentlich bei Schiele und konnte so seinen
manchmal sprunghaften künstlerischen Aufstieg
verfolgen. Daß ich, soweit es meine bescheidenen
Mittel als vermögensloser Beamter gestatteten,
||
5.
auch Sammler wurde, ist selbstverständlich; jeden
Heller, den ich nicht für den Haushalt und die
Familie brauchte, trug ich zu Schiele.
Schiele war nicht nur als Künstler, sondern
auch als Mensch ungewöhnlich. Der Grundzug sei-
nes Wesens war der Ernst; aber nicht ein
düsterer, melancholischer, kopfhängerischer, sondern
der ruhige Ernst des von seiner geistigen
Aufgabe erfüllten Menschen. Die Dinge des All-
tags konnten ihn nicht anfechten; sein Blick
war immer, über sie hinweg, auf sein hohes
Ziel gerichtet. Dabei war er durchaus humo-
ristisch veranlagt und zum Scherzen geneigt;
seine Lustigkeit äußerte sich aber niemals
geräuschvoll; wenn sie hoch stieg, kulminierte
sin in einem kurzen, stoßweisen nicht sehr lau-
ten Gelächter. Wenn er z. B. seinen alten
Akademielehrer, Professor Griepenkerl in Stimme
und Haltung karikierte, konnte man sich
krumm lachen. Schiele war Griepenkerls „enfant
terrible“. Eines Tages sagte dieser in der
||
6.
Verzweiflung über den jungen Stürmer, der
sich über alle akademischen Kunstregeln hin-
wegsetzte: „Sagen Sie um Gotteswillen nie-
mandem, daß sie bei mir gelernt haben.“
Schieles heitere Ruhe war unerschütterlich; er
verlor sie nicht in den schwierigsten, widerwär-
tigsten Lagen seines Lebens. Im Gegenteil: je
unangenehmer es wurde, desto mehr steigerte sich
seine Heiterkeit. Ich habe ihn in den 8 Jahren un-
serer Bekanntschaft nicht ein einziges Mal zor-
nig oder auch nur ungehalten gesehen oder
bei ihm eine verdrossene Miene beobachtet. Er
wartete ruhig, bis irgendwoher die Hilfe kam
und sie kam immer, wenn auch in zwölfter
Stunde. Er war nicht nur ein bildender Künst-
ler, sondern auch ein Lebenskünstler im vollsten
Sinne des Wortes. Wenn ein Wiener Kunst-
kritiker anläßlich der 25. Wiederkehr von
Schieles Todestag schieb: „Sein kurzes Leben ist
tragisch umdüstert“, so gibt das einen ganz fal-
schen Begriff von Schieles Lebensführung. Tragisch
||
7.
ist nur, was man tragisch nimmt und Schiele
nahm nichts tragisch. Eine Tragödie in seinem
Leben war nur seine gerichtliche Belangung und
sein und seiner Gattin schneller, früher Tod.
Schieles Natur war kindlich (nicht kindisch). Kurz
bevor ich ihn kennen lernte, hatte ihn der Kunst-
sammler Karl Reininghaus besucht und sich so für
Schieles Zeichnungen begeistert, daß er eine größere
Zahl davon ankaufte und sofort honorierte. Schiele
zeigte mir nun, wie damals sein Rock vom
Körper abstand, weil er die dicke Brieftasche
nicht fassen konnte. Schiele ging im Sommer
dieses Jahres mit mehreren Freunden in die schöne
alte Stadt Krumau in Böhmen, die Heimatstadt
seiner Mutter, und als er zurückkehrte, paßte
der Rock wieder ausgezeichnet.
Schiele war ein guter, selbstloser und (eine
bei Künstlern seltene Eigenschaft) neidloser
Mensch. Ich sagte zu ihm eines Tages, ich würde
gern ein Bild des Malers Anton Faistauer er-
werben, was er dazu sage? Obwohl Schiele die
||
8.
Bescheidenheit meiner Mittel kannte und wußte,
daß der hiefür aufgewendete Betrag ihm entging,
antwortete er ohne Zögern: „Ja, einen Faistauer
muß man wohl haben.“ Schieles Freund und spä-
terer Schwager, Maler Anton Peschka arbeitete
jahrelang in Schieles Atelier mit dessen Material
und ließ auf Schieles Kosten bei dessen Schneider
arbeiten. Ich zweifle nicht, daß Schiele auch ande-
ren Freunden und Berufskollegen aushalf, soweit
er konnte; ich glaube auch, daß er seine Mutter,
obwohl sie eine Witwenpension bezog, materiell
unterstützen mußte. Damit komme ich zu einem
der schwächsten Kapitel in Egon Schieles Leben:
der Geldwirtschaft.
Ein Künstler von Bedeutung darf in Geld-
sachen nicht kleinlich sein, weil man von ihm
Großzügigkeit voraussetzt. Einen großen Künst-
ler als Pfennigfuchser kann ich mir nicht vor-
stellen, wohl aber als Verschwender. Bei Schiele
ging aber die Sorglosigkeit in Geldsachen so weit,
daß man von Leichtsinn sprechen dürfte. Als Bei-
||
9.
spiel: Ich saß mit Schiele und seinem Modell (und
Liebling) Vally Neuzil in Hietzing im Kaffeehause.
Während Schiele Karambol spielte, erzählte mir Vally,
daß Egon ganz blank sei und nicht wisse, wie er
am nächsten Tage sein Mittagessen bezahlen solle.
Ich war damals selber knapp, gab aber Schiele,
nachdem er sein Spiel beendet hatte, für den
dringendsten Bedarf 10 Kronen. Was tut nun unser
Egon? Er fährt, nachdem wir uns getrennt
hatten, mit Vally in’s Burgtheater, geht nach
Beendigung der Vorstellung mit ihr in’s Res-
taurant und erübrigt von den 10 Kronen ge-
rade noch so viel, um mit der Elektrischen nach
Hause fahren zu können.
Oder: Ich war mit Schiele und Vally in sei-
nem Atelier in der Hietzinger Hauptstraße.
Es läutet. Vally öffnet und es erscheint ein sehr
freundlicher älterer Herr, der sich als Steuerexe-
kutor vorstellte. Er sei vom Gericht beauftragt, hier
zu pfänden und Siegel anzulegen, wenn nicht die
eingeklagte Schuld beglichen würde. Sie betraf das
||
10.
Guthaben eines Wiener Spediteurs für die Verpackung
und den Transport von Schieles Bildern nach Deutsch-
land. Schiele war vom Gläubiger und vom Gerichte
wiederholt zur Zahlung aufgefordert worden, hatte
aber gerade (dieses „gerade“ war bei ihm zeitlich
recht ausgedehnt) kein Geld und steckte daher die
Zuschriften einfach in den Ofen. So war der schul-
dige Betrag durch allerlei Spesen auf die doppelte
Höhe angewachsen. Da nichts anderes zu machen
war, zahlte ich und begleitete den sehr befriedig-
ten Herrn Exekutor zur Wohnungstür. Als ich
in’s Atelier zurückkam, mochte ich wohl ein sehr
unglückliches Gesicht gemacht haben, denn Schiele
und Vally empfingen mich mit hellem Gelächter.
Schiele sah mich, wie immer freundlich lächelnd, an
und sagte: „Armer Herr B!“ (Er nannte mich
immer mit meinem Anfangsbuchstaben) Darauf
lachten sie abermals und zuletzt auch ich, womit
die Ordnung wieder hergestellt war.
Schiele machte öfter zur Sommerzeit mit Vally
oder mit Mutter und jüngerer Schwester kleine
||
11.
Reisen in die oesterreichischen Alpenländer bei denen,
meines Wissens, er die Kosten trug. Diese Reisen
waren meist von Haus aus finanziell schlecht fun-
diert und wurden oft so lange ausgedehnt, bis
man irgendwo festsaß und selbst das Geld zur
Rückreise fehlte. Da kam dann ein Brief: „Lieber
Herr B!“ u.s.w. Ich fluchte, aber ich zahlte, denn
sitzen konnte man ihn ja nicht lassen. Wenn
ich ihn dann nach seiner Rückkehr Vorwürfe mach-
te und fragte: „Was wäre denn gewesen, wenn ich
kein Geld gehabt hätte?“ sagte er: „Wenn’s sein
muß, haben Sie schon eines.“ Da hatte er nun wie-
der recht.
Schiele war auch leichtsinnig beim Versenden
seiner Zeichnungen. Dem Kunsthändler Goltz in
München schickte er dutzende von Zeichnungen,
die einfach (ohne Kartonhülle) in Packpapier ein-
gerollt waren und unverschlossen, bloß mit den
erforderlichen Postmarken beklebt, nicht eingeschrie-
ben zur Post gegeben wurden.
Von dem Tage, an dem ich begann, Schiele zu
||
13.
sammeln, war ich von einem Gefühle tiefer Dank-
barkeit gegen den Künstler durchdrungen, der
mir durch seine Werke so viel Glück beschert
hatte. Ich war daher immer bestrebt, nicht so billig
als möglich zu kaufen, sondern aus mir so
viel als möglich für den Künstler herauszuholen.
Schiele hat dies auch dankbar anerkannt, indem
er einmal zu Peschka (nicht in meiner Anwe-
senheit) sagte: „Der Herr B. ist mein bester Zahler.“
Dabei hatte Schiele sehr reiche Kunstfreunde, darunter
einen Döblinger Millionär, der einmal zu einem
Freunde sagte: „Der Benesch ist ein Narr, daß
er dem Schiele mehr zahlt, als er muß.“ Dieser
Millionär kaufte am billigsten und das kam so:
Ich konnte jeweils nur ein Blatt, besten falls zwei
Blätter auf einmal kaufen und Schiele bekam daher
von mir immer nur kleinere Beträge. Wenn
er nun mehr brauchte, rollte er ein Dutzend oder
mehr nicht aquarellierter Zeichnungen zusammen
und fuhr damit zu seinem Döblinger Millionär
hinaus. Der sah sich die Blätter ruhig, ohne Zeichen
||
14.
der Begeisterung an und sagte endlich: „Ja, ich brauche
die Sachen nicht; wenn Sie 10 Kronen für das Stück
wollen, können Sie sie hier lassen.“ Und Schiele
nahm die 120 Kronen für das Dutzend und fuhr
erleichtert nach Hause.
Psychologisch interessant war, daß Schiele, der meine
Opferwilligkeit anerkannte und schätzte, gerade mich,
den Mann der kleinen Mittel zeitweise mit den
Preisen steigerte. Ich widersprach nie und verlang-
samte nur notgedrungen das Tempo meiner Samm-
lertätigkeit. Schiele sagte einmal: „Wie schade
Herr B, daß sie kein Geld haben.“ Ja, das tat mir
am meisten leid um der Kunst und der Künst-
ler willen.
Es kam auch öfter vor, daß mir Schiele den
Ankauf eines Blattes verweigerte, auch wenn ich es
nicht von meinem Guthaben (Schiele war immer
bei mir in der Kreide) abziehen, sondern bar
bezahlen wollte. Warum? – ich weiß es nicht.
Er sagte einfach: „Das geb‘ ich nicht her“ und ich
gab mich zufrieden. Wenn ich aber dann dieses
||
15.
Blatt bei dem Döblinger Millionär (den ich öfter
besuchte) wiedersah, der es mit 10 Kronen be-
zahlt hatte, obwohl ich es nach der Damaligen, von
Schiele für mich festgesetzten Preislage mit 30 Kro-
nen honoriert hätte, dann konnte ich wohl fuchs-
teufelswild werden. Mein Zorn war aber im-
mer schon verraucht, wenn ich wieder zu Schiele
kam und ich machte ihm nie einen Vorwurf
daraus. Schließlich darf man einem Menschen,
der im guten Sinne Ungewöhnliches leistet, nicht
im übrigen mit dem Maßstabe des Spießbür-
gers messen.
Ich genoß aber nicht nur Schieles kleine Launen,
sondern auch seine Noblesse, denn er war eine
noble Natur. Wenn mein Guthaben schon höher
angestiegen war und durch Kunstwerke (nie-
mals bar) ausgeglichen wurde, versäumte
Schiele niemals, ein gutes Blatt als Draufgabe
zuzulegen.
Ich hatte mich im Laufe der Jahre oft an
Hilfs- Rettungs- und sonstigen Aktionen zugunsten
||
16.
Schieles beteiligt. Wenn eine gelungen war, quittier-
te dies Schiele anerkennend durch die Bemer-
kung: „Herr B. hat’s gemacht.“
Einmal – in einer Zeit größter Ebbe – bat mich
Schiele, zu Klimt zu gehen und ihm seine Nöte
vorzutragen. (Schiele selbst mochte es nicht tun.)
Klimt sei am besten in der Zeit zwischen 7 und 8
Uhr Morgens in der Meierei Tivoli am Grünen
Berge bei Schönbrunn zu treffen, wo wer täglich
sein Frühstück einnahm. Ich war am nächsten Tage
zur Stelle, traf Klimt, den ich schon persönlich
kannte, den Architekten Prutscher und noch
einen Herrn aus Künstlerkreisen, dessen Name
mir entfallen ist. Eben kam der Kellner mit
Klimts Frühstück, dabei ein gar nicht kleiner
Teller mit einem wahren Berge von Schlagobers.
Klimt blickte skeptisch auf den Teller und sagte:
„So wenig!“ ich bewunderte seit dieser Zeit Klimt
nicht nur wegen seiner Kunst, sondern auch we-
gen seines guten Magens. Ich brachte meine
Sache vor. Architekt Prutscher entwickelte sofort
||
17.
eine Reihe von Vorschlägen, von denen neun
Zehntel für Schiele nicht brauchbar waren.
Klimt sprach, wie gewöhnlich, nicht viel und sag-
te nur, er werde schon etwas machen. Tat-
sächlich empfahl er Schiele der kunstsinnigen
Familie des Großindustriellen August Lederer,
die sofort die Beziehungen zu Schiele auf-
nahm, viel von ihm kaufte und mit ihm in
dauernder Verbindung blieb. Schiele war
damit für längere Zeit aus dem Gröbsten
heraus.
Und nun komme ich zu einer ganz miß-
glückten Hilfsaktion, bei der der „gute“ On-
kel Czihaczek die Hauptrolle spielte.
Der Oberinspektor der Nordbahn, Ingenieur
Czihaczek (sein Vorname ist mir entfallen)
war der Gatte der Schwester von Egon Schieles
Vater. Das kinderlose Ehepaar lebte in Wien
in sehr guten Verhältnissen. Nach dem Tode von
Vater Schiele wurde Onkel Czihaczek Egons Vor-
mund und die Familie Schiele übersiedelte von
||
18.
Tulln nach Klosterneuburg, wo Egon das Gymnasium
besuchte. Er kam aber mit dem Studium nicht recht
vorwärts; der Drang nach der Kunst war über-
mächtig. Onkel Czihaczek wollte aber nicht, daß
Egon das unsichere Leben des Künstlers führe, er
sollte einen „nützlichen“ Beruf ergreifen, der ihm
sicheres Brot und Pensionsberechtigung brachte.
Endlich gab der Onkel seinen Widerstand auf;
Schiele kam 1906 an die Wiener Kunstakademie
und verließ sie 1909. Im Jahre 1910 sehen wir ihn
schon als selbständig schaffenden Künstler in sei-
nem Atelier in der Grünbergstraße. 31 tätig.
Von dieser Zeit an bracht er die Beziehungen
zum Onkel ab, sah aber die Tante öfter, die
eine heitere, lebenskluge Frau war und auf
Egons Seite stand.
Inwieweit Onkel Czihaczek Schiele unterstützte
und für ihn Opfer brachte, weiß ich nicht. Mir gegen-
über erwähnte Schiele nur, daß er öfters im Hau-
se des Onkels zu Tisch war und manchmal in die
Loge des Burgtheaters (Czihaczeks hatten ein Abonne-
||
19.
ment) mitgenommen wurde.
Im Frühjahre 1913 ging es Schiele sehr schlecht.
Er nährte sich ungenügend und ungleichmäßig,
was sich bald in seinem Aussehen zeigte. Auf einem
Selbstbildnisse aus diesem Jahre, einer Bleistift-
zeichnung, die für eine Schiele-Mappe reproduziert
wurde, ist dies deutlich sichtbar. Wir hielten da-
mals zu zweit eine Notstands-Sitzung ab und ich
verfiel endlich, nach Prüfung aller Hilfsquellen,
auf Onkel Czihaczek. Schiele lachte und meinte, da
werde ich kein Glück haben. Ich wollte es dennoch
versuchen.
Ich suchte den damals schon pensionierten On-
kel Czihaczek in seinem Heim in der Leopold-
stadt auf. Ich wurde (nur von ihm) höflich, aber
sehr kühl empfangen. Der Zweck meines Besuches
war ihm noch nicht bekannt. Ich will mein Urteil
über ihn in wenige Worte zusammenfassen:
kalt, verschlossen, selbstgefällig, pedantisch, hinterhäl-
tig – wenig intelligent.
Ich brachte meine Sache vor, verwies zunächst auf
||
20.
Schieles zweifellose Künstlerschaft, die Großes versprach,
schilderte seine augenblickliche Notlage und bat end-
lich um Hilfe. Der Onkel hörte mich ruhig, mit hartem,
abweisendem Gesichte an und sagte endlich: „Das
ist ausgeschlossen.“
Ich legte noch einmal, kräftiger los und betonte,
daß Schiele derzeit nicht in der Lage sei, sich aus-
reichend zu ernähren, und oft dem Hunger nicht
ferne stehe. Die ruhige, kalte Antwort lautete:
„So arg wird es wohl nicht sein.“ Auch ein dritter
Versuch, das steinerne Herz zu rühren, erzielte nur
die Antwort: „Es ist ausgeschlossen!“. Ich erkannte
die Lage als hoffnungslos und empfahl mich mit
stummer Verbeugung, die ebenso erwidert
wurde.
Als ich Schiele hierüber berichtete, meinte er:
„Was habe ich Ihnen gesagt!“ Dann lächelte er
mich freundlich an und sagte: „Armer Herr B!“
In der Schiele-Literatur und in den Zei-
tungsartikeln, die besonders nach Schieles Tode
erschienen, war wiederholt darauf verwiesen,
||
21.
daß ihn sein Onkel (Czihaczek) gefördert und unter-
stützt habe. Nun, gefördert hat er ihn wohl nie,
denn er hat seinem Bestreben, Künstler zu wer-
den, immer den schärfsten Widerstand entgegen-
gesetzt; und unterstützt hat er ihn vielleicht wäh-
rend der Dauer der Vormundschaft, nach Schieles
selbständigem Auftreten aber gewiß nicht. Er
kümmerte sich einfach nicht mehr um ihn und ver-
hielt sich durchaus ablehnend.
Man muß Onkel Czihaczek indes zugute halten,
daß er für Schieles Kunst nicht das mindeste Ver-
ständnis hatte, obwohl ihm hiezu reichlich Gelegenheit
geboten war, denn Schieles Talent zeigte sich sehr
früh. Schon als kleiner Knabe beobachtete er am
Bahnhofe in Tulln (N.Ö. [Niederösterreich]) wo sein Vater Vorstand
war, mit großem Interesse den Zugverkehr
und die Verschiebungen und begann zu zeichnen.
Tante Czihaczek, die ich nach ihres Gatten Tode öfter
besuchte, zeigte mir einmal einen schmalen Strei-
fen weißen Papieres, auf den der kleine Egon
einen durchfahrenden Schnellzug gezeichnet hatte.
||
22.
Es war die überzeugendste Darstellung dieser
Impression, die ich je gesehen habe. Die kleinen
Räder waren wie mit dem Zirkel gezogen;
die Radspeichen, die nur an der Nabe sichtbar
waren und der zerflatternde Rauch aus der
Lokomotive ließen die große Geschwindigkeit
erkennen. Erst nach Schieles großer Ausstellung
in der Sezession im März 1918, als sein Name
in Aller Munde war und die Zeitungen
lobende Artikel brachten, wurde der Onkel auf-
merksam. Aber erst nach Schieles Tode wurde
er der lauteste Verkünder des Ruhmes seines
Neffen und war sogar stolz auf ihn.
Wenn Schieles Persönlichkeit ehrlich geschildert
werden soll, darf man an den Schwächen seines
Charakters nicht vorübergehen.
Schiele war, wie sein großer Kollege Klimt,
Erotiker. Er zeichnete und malte, was er sah
und kannte kein Feigenblatt. Er war infolge-
dessen in sexuellen Dingen von großer Freiheit.
Bei den Berufsmodellen mochte dies angehen,
||
23.
nicht aber bei Kindern, nach denen er viel
und gerne Akt zeichnete. Er nahm hiebei auf die
Unverdorbenheit der Kinder (die allerdings
oft nicht mehr vorhanden war) keine Rücksicht.
Es geschah dies gewiß nicht aus Schlechtigkeit, son-
dern aus Gedankenlosigkeit und Sorglosigkeit. Er
hat sich an den Kindern nie schwerer vergangen.
Immerhin führte diese Tatsache zur Katastrophe
von Neulengbach, von der später noch die
Rede sein soll.
Ein zweiter Vorwurf, den Schiele selbst seine
Freunde machen müssen, ist der der unsoliden
Arbeit bei seinen Oelbildern. Er legte auf die
Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit seiner Oelmalerei
keinen Wert und das darf ein Künstler nicht;
nicht nur aus Achtung vor der Kunst und dem
eigenen Werke, sondern auch aus Rücksicht auf
den Käufer. Er arbeitete oft mit minder-
wertigen, unzulänglichen Malmitteln, wenn
das Geld für Besseres nicht ausreichte. Im
Eifer der Arbeit mischte er mitunter die Farbe
||
24.
so oberflächlich mit dem Malmittel, daß sich die-
ses von der Farbe absetzte. Es sind daher viele
seiner Oelbilder heute schon Ruinen, die zu
ihrer Erhaltung sorgfältiger Pflege bedürfen.
Die Würdigung von Schieles Kunst ist Sache
des Kunsthistorikers, der ich nicht bin. Wenn ich
dennoch darüber spreche, so gebe ich damit nur
ein ganz allgemeines, rein persönliches Urteil ab.
Schiele war ein universeller Künstler größten
Stils. Seine Kunst ist im höchsten Maße eigenartig; es
besteht nichts auch nur Ähnliches neben ihr. Was
er anpackte, war Kunst, ob es nun Zeichnen, Ma-
lerei, Plastik oder Kunstgewerbe war; etwa
ein Monogramm zu einem Petschaft oder ein
Entwurf zu einem Zierpolster. Ließ er sich doch
seine Anzüge (auch hinsichtlich des Schnittes) nach
seinen Angaben herstellen und er sah darin,
trotz kleiner Absonderlichkeiten, prächtig aus.
Was Schiele uns in Form und Farbe an
Schönheit brachte, war vor ihm noch nicht erlebt
worden. Für seine Zeichenkunst gibt es nur einen
||
25.
Ausdruck: phänomenal. Die Sicherheit seiner
Hand war fast unfehlbar. Beim Zeichnen saß er
wohl öfter auf einem niedrigen Schemel, das Reiß-
brett mit dem Zeichenblatte auf den Knieen [!],
die zeichnende rechte Hand auf die Unterlage ge-
stützt; aber er konnte auch anders. Ich sah ihn
zeichnen, vor dem Modelle stehend, den rechten Fuß
auf einem niedrigen Schemel aufgesetzt. Das Reiß-
brett stützte er auf das rechte Knie und hielt es
mit der Linken am oberen Rande fest. Nun
setzte er den Bleistift mit freistehender Hand
senkrecht auf das Blatt und zog, sozusagen aus
dem Schultergelenke heraus, seine Linien. Und
das saß alles richtig und fest. Kam er ein-
mal daneben, was äußerst selten der Fall
war, so warf er das Blatt weg. Er kannte
keinen Radiergummi.
Schiele schuf seine Zeichnungen nur vor der
Natur. Sie waren im wesentlichen Konturzeich-
nungen, die erst durch die Farbe höhere Plastik
erhielten. Die Kolorierung erfolgte immer
||
26.
ohne Modell aus dem Gedächtnisse, ein Beweis, daß
Schiele die Kenntnis des menschlichen Körpers bis
in’s [!] kleinste besaß.
Im Jahre 1917 fing Schiele an bei seinen Zeich-
nungen in der Farbe etwas roh zu werden.
Die zarten Töne der menschlichen Haut wurden
derb, so daß die Akte manchmal ganz scheckig
aussahen. Als ich ihn einmal diesbezüglich aus-
holte, meinte er, die Farbe wäre gar nicht
nötig, man könne alles mit dem Stifte aus-
drücken. Tatsächlich kolorierte er später seine
Zeichnungen nicht mehr und wendete zur Er-
höhung ihrer Plastik einen breiten, weichen,
sehr lockeren, schummerigen Strich an, der die
Farbe nicht vermissen ließ und Schieles Gestal-
tungskraft in neuem Lichte zeigte.
Im Jahre 1917 und anfangs 1918 entstand eine
große Menge von Aktzeichnungen, die ledig-
lich Schieles Virtuosität zeigten, geistig aber
leer und inhaltslos, also wenig erfreulich wa-
ren. Ich glaube, darin den nachteiligen Einfluß
||
27.
seiner Frau zu sehen, die ihn wegen der höheren
Kosten des ehelichen Haushaltes zu größerer Tätig-
keit anspornte. Schiele war nie faul, aber er
folgte bei seinem Schaffen immer nur dem inne-
ren künstlerischen Triebe, niemals der Zweckmä-
ßigkeit (Verkaufsmöglichkeit).
Nach meinem persönlichen Empfinden stand
Schieles Kunst in den Jahren 1910, 1911 und 1912
auf dem Höhepunkte. Das Liebste von Allem
sind mir seine Zeichnungen aus dem Jahre 1910.
Die Interieur-Zeichnungen jedoch, die Schiele
im Jahre 1917 als Militärpflichtiger in einem
ärarischen Verpflegsmagazin schuf, gehören,
glaube ich, zum Höchsten, was Zeichenkunst
jemals geleistet hat.
Schiele war auch Sammler, aber er sammel-
te nicht Wertvolles, sondern kleine Dinge, Nich-
tigkeiten, die durch Form und Farbe seinem
künstlerischen Empfinden entsprachen: Kleines
bemaltes Kinderspielzeug, kleine bäuerliche
Holzplastiken und Hinterglasmalereien, bunte
||
28.
Stickereien und Kopftücher und Ähnliches. Seine
Vitrine sah aber interessanter aus, als die man-
ches reichen Kunstfreundes.
Im Somme 1911 übersiedelte Schiele von
der Grünbergstraße im 12. Bezirke nach Neu-
lengbach (N.Ö.). Er begründete diesen Schritt
damit, daß er auf dem Lande viel freier
und ungehinderter schaffen könne. Er bewohn-
te dort ein am Südabhange des Buchberges
liegendes, aus zwei sehr hellen, geräumigen
Zimmern, Küche und Vorraum bestehendes
Einfamilienhaus mit hübschem Garten. Die
Aussicht von seinen Zimmern war herrlich:
Links die Ausläufer des Wienerwaldes; gerade-
aus, auf bewaldetem Hügel, Schloß Neuleng-
bach; rechts der Haspelwald und der Beginn
des Tullnerfeldes. Schiele war dort meist allein.
Vally blieb in Wien, besuchte ihn aber oft. Die
Zeit, die Schiele in Neulengbach verbrachte,
dürfte die glücklichste seines Lebens gewesen
sein, was schon aus der reichen, hochwertigen
||
29.
künstlerischen Produktion aus jener Zeit zu ent-
nehmen ist.
Dann kam das Verhängnis.
Ich hatte Schiele immer gewarnt, beim Umgan-
ge mit seinen Kindermodellen vorsichtig zu sein
und nichts ohne Einverständnis der Eltern
zu unternehmen. Er gab mir hierüber beru-
higende Erklärungen.
An einem Märzabend des Jahres 1912
kam Mutter Schiele mit ihrer jüngeren Tochter
Gertrud in größter Verzweiflung in meine
Wohnung und teilte mir mit, daß Egon gestern
in Neulengbach verhaftet worden sei. Man be-
schuldige ihn der „Unsittlichkeit“ und „Entführung“.
Ich ahnte sofort den Zusammenhang. Herr
Karl Reininghaus, der gleichzeitig verständigt
worden war, stellte Rechtsschutz kostenlos bei.
Ich fuhr am nächsten Tage nach Neulengbach
und durfte Schiele sprechen. Ich tröstete ihn und
sprach ihm Mut zu. Er war sehr gedrückt, aber
der kindlich heitere Ausdruck in seinem Gesichte
||
30.
blieb unverändert. Er blieb ungefähr 14 Tage
im Gewahrsam des Bezirksgerichtes Neulengbach
und ich besuchte ihn dort noch zweimal. Dann
wurde er nach St. Pölten gebracht, wo das Kreis-
gericht das Verfahren gegen ihn durchführte.
Der Vorwurf der „Unsittlichkeit“ war durch
folgenden Tatbestand gegeben: Schiele duldete
es in seiner Gutmütigkeit, daß nach Beendi-
gung der Arbeit nach Kindermodellen oft
ganze Scharen von kleinen Knaben und
Mädchen, die Schulkameraden und Kame-
radinnen der Modelle, in das Arbeitszim-
mer kamen und sich dort herumtummelten.
Schiele hatte nun ein wundervolles farbiges
Blatt, ein ganz junges, nur am Oberkörper
bekleidetes Mädchen darstellend, mit Haftnägeln
an der Wand befestigt. Der Körper war so
dargestellt, wie Gott ihn erschaffen. Die nicht
mehr unschuldigen unter den Kindern tuschel-
ten über die Nudität, erzählten davon und
so kam es zur Anzeige.
||
31.
Das schöne Blatt wurde später über Gerichts-
beschluß vernichtet. – Sancta simplicitas.
Nun die „Entführung“, wie sie mir darge-
stellt wurde:
In Neulengbach lebte damals ein Marine-
beamter mit Frau und etwa 15 jähriger Tochter,
die in den hübschen Schiele verliebt sein mochte,
denn sie lief ihm unausgesetzt nach. Schiele
verhielt sich durchaus gleichgültig. Eines Tages
stand Schiele mit Vally am Bahnsteige der
Haltestelle Neulengbach Markt, um nach Wien
zu fahren. Da erschien das Mädchen, erklärte,
es wolle nicht mehr bei seinen Eltern blei-
ben, es wolle zur Großmutter nach Wien
und bat, mitgenommen zu werden. Da die
Kleine kein Geld hatte, bezahlte Schiele die
Fahrkarte und sie fuhren zusammen nach Wien.
Als sie daselbst eintrafen, war es Abend ge-
worden. Das Mädchen wollte nicht so spät
zur Großmutter kommen, daher wurde es
in’s [!] Hotel mitgenommen, wo alle drei über-
||
32.
nachteten; Schiele im abgesonderten Zimmer.
Am nächsten Tage wurde das Mädchen zur
Großmutter gebracht, aber noch am selben Tage
von den Eltern heimgeholt. Schiele hatte also
ihre Flucht aus dem Elternhause unterstützt,
was als „Entführung“ qualifiziert wurde. Die
Anklage wegen Entführung soll bei der Ver-
handlung des Kreisgerichtes St. Pölten gegen
Schiele fallengelassen worden sein.
Die Verhandlung fand, meines Erinnerns,
ungefähr eine Woche nach Schieles Überstellung
nach St. Pölten statt. Welches Ergebnis sie hatte,
weiß ich nicht. Ich habe Schiele befragt, aber
er wollte darüber nicht sprechen und ich
drang nicht auf Antwort. Irgendwer aus
Schieles Umgebung – ich weiß nicht mehr, wer
es war – sagte mir, er wäre nur wegen
Unsittlichkeit zu drei Tagen Arrestes verur-
teilt worden. Jedenfalls wurde er einige
Tage nach der Verhandlung aus der Haft
entlassen und diese Tatsache beweist, daß keiner-
||
33.
lei schweres Verschulden vorlag.
Schieles Mutter, Vally und ich holten Schiele
aus St. Pölten ab. Die Frauen warteten auf dem
Bahnhofe und ich begab mich allein nach dem
Kreisgerichte. Als ich mit Schiele das Gebäude ver-
ließ, atmete er tief auf und sein Gesicht ließ
das Glück über die wiedererlangte Freiheit
erkennen.
Man gestattete, daß Schiele während seiner
Haft mit Arbeitsmaterial versehen wurde. Er
brachte auch etwa ein Dutzend farbiger Zeich-
nungen aus Neulengbach und St. Pölten heim.
Drei in Neulengbach entstandene, bisher nicht
reproduzierte farbige Blätter besitze ich. Sie
sind interessant genug, um besonders beschrie-
ben zu werden:
Das erste zeigt Schiele, auf der Pritsche
liegend, mit seinem rotbraunen Mantel
zugedeckt. Das Blatt trägt ober der Signie-
rung und Datierung mit dem Tage des Ent-
stehens die Inschrift: „Den Künstler hemmen ist
||
34.
ein Verbrechen, es heißt keimendes Leben morden.“
Das zweite Blatt zeigt Schiele, vorgebeugt sit-
zend, mit umgehängtem Mantel, der aber grau
getönt ist. Sein Gesicht ist von einem grinsenden,
wie verzweifeltem Lachen überzogen, die Inschrift
lautet: „Gefangener!“.
Das dritte Blatt gibt einen Blick von der Prit-
sche nach der Tür ober der sich ein großes, schwer
vergittertes Oberlichtfenster befindet. Durch dieses
sieht man auf ein paar Dachfirste und Rauch-
fänge sowie auf zwei junge, noch unbelaubte
Bäume, auf denen einige Meisen sitzen. Es ist
eine liebliche kleine Frühlingslandschaft voll
Sehnsucht nach der Freiheit. Das Blatt zeigt die
Inschrift: „Die Tür in das Offene.“ Beide letzt-
genannte Blätter sind ebenfalls signiert und
voll datiert.
Ich besitze ferner eine kleine Plastik, die
aus Brot geknetet und modelliert ist. Sie stellt
das Porträt eines St. Pöltener Häftlings dar
und hat nur Nußgröße, ist aber von ungewöhnlicher
||
35.
Charakteristik – ein wahres Meisterstück im Kleinen.
Schiele betrat Neulengbach, wo er so glücklich
und erfolgreich gewesen war, nie wieder. Auf
seine Bitte leitete ich seine Übersiedlung nach
Wien in die Wege, wo er zunächst bei seiner
Mutter in Ober-Hetzendorf wohnte. Da er dort
keine Arbeitsmöglichkeit hatte, ging er als Gast
in das Atelier eines Maler-Freundes, der sich
Mime van Osen nannte; ein genial veranlag-
ter Mann, der seinerzeit als Theatermaler am
deutschen Theater in Prag tätig gewesen war,
aber infolge seiner ungezügelten Lebensweise
nirgends Fuß fassen konnte. Leider wurde der
gutgläubige Schiele von diesem Mann schwer
getäuscht und materiell geschädigt.
Als sich Schiele finanziell etwas erholt hatte,
bezog er ein eigenes Atelier in der Hietzinger
Hauptstraße Nr 101, wo er bis zum Beginn des
Jahres 1918 verblieb. Im Jahre 1913 entspann sich
dort ein zartes Verhältnis zu der jüngeren
Tochter Edith des kleinen Eisenindustriellen
||
36.
Johann Heinrich Harms der gegenüber im eige-
nen Hause, Hietzinger Hauptstraße Nr 114 wohnte.
Im Jahre 1915 wurde geheiratet.
Die Ehe lief gut an, nur war Frau Schiele,
eine mondäne, mittelgroße, sehr bewegliche Blon-
dine stark eifersüchtig, was aber an Schieles
heiterem Gleichmute wirkungslos abprallte. So
durfte er anfangs nur nach ihr Akt zeichnen.
Als sie aber anfing etwas füllig zu werden,
Schiele aber schlanke Figuren künstlerisch bevor-
zugte, mußte sie schließlich auch andere Modelle
dulden; aber sie paßte scharf auf.
Im Jahre 1915, dem zweiten des ersten Welt-
krieges wurde Schiele kurz vor seiner Eheschließung
für den Militärdienst gemustert. Ich war wie
vor den Kopf geschlagen, als ich von ihm eine
Karte erhielt, worauf stand:
„geeignet“, am 21. Juni nach Prag einrücken!
Beste Grüße Egon Schiele.“
Also der zarte Schiele mit dem femininen Knochen-
bau und dem zwar gesunden aber schwach ent-
||
37.
wickelten Kinderherzen (ärztlich festgestellt) war
kriegsdiensttauglich.
Schiele kam nach der Einrückung zur Abrich-
tung nach Neuhaus in Böhmen. Er schrieb mir,
daß die ersten 14 Tage seiner dortigen Tätig-
keit die schlimmsten seines Lebens gewesen seien.
Man mochte wohl bald erkannt haben, daß
Schiele kein Frontsoldat war. Er kam nach Wien
zurück und wurde einem Wachkommando auf
der Sofienalpe zugeteilt. Bald darauf wurde
er dem Gefangenenlager in Mühling bei
Scheibbs in Niederoesterreich als Schreibkraft zu-
gewiesen, wo er viele Porträts von oesterrei-
chischen Offizieren und russischen Gefangenen zeich-
nete. Später war er in Wien in einem ära-
rischen Verpflegsmagazin beschäftigt und wurde
nach einigen Monaten dieser Tätigkeit dem
Heeresmuseum im Wiener Arsenal zugewiesen.
Dort hatte er viel übrige Zeit und konnte
sich wieder seinen künstlerischen Aufgaben widmen.
Da Schiele die Absicht hatte, Bilder großen
||
38.
Formates zu malen (eine Studie zu einem „Heiligen
Abendmahl“ ist vorhanden) wozu sein Atelier in
der Hietzinger Hauptstraße nicht hoch genug
war, übersiedelte er zu Beginn des Jahres
1918 in ein ehemaliges Bildhaueratelier in
Hietzing, Wattmanngasse Nr 6, in dem sich
ein etwa 7 Meter hoher, ferner ein kleinerer Ar-
beitsraum und ein Wohnzimmer befanden.
Dort sah ich noch die Vorbereitungen zu dem ob-
erwähnten großen Bilde: Den Blendrahmen
und die Leinwand; zur Ausführung sollte es
nicht mehr kommen.
Schiele hatte im Laufe der Jahre nicht
nur in Oesterreich und Deutschland, sondern auch
im Auslande ausgestellt. Seine erste Wiener
Ausstellung hatte er im Jahre 1911 in der Ga-
lerie des Kunsthändlers Miethke in der Do-
rotheergasse. Ich traf ihn einmal in der inneren
Stadt auf dem Wege dahin. Er wollte sich wie
er sagte, „den ersten Tausender holen“. Er
brachte aber keinen Tausender heim, ja nicht
||
39.
einmal einen Hunderter. Das war aber nicht seine
Schuld, sondern die der Wiener, die ihn noch
nicht verstanden. Es wären in dieser Kollektiv-
Ausstellung viele schöne Dinge wohlfeil zu haben
gewesen.
Ein Jahr später beteiligte sich Schiele als Gast
an einer Ausstellung des Künstlerbundes
„Hagen“ in der Zedlitzgasse. Dort sah man
nebst anderen trefflichen Arbeiten sein großes
Bild „Die Eremiten“, das allgemeine Beach-
tung fand und die Aufmerksamkeit auf den
Künstler lenkte.
Im Jahre 1914 lud Karl Reininghaus die
modernen jungen Künstler zu einem Wett-
bewerbe ein, an dem sie sich mit je einem
Werke beteiligen konnten. Es war ein erster
Preis von 2000 Kronen und ein zweiter von
1000 Kronen ausgesetzt. Schiele tat mit. Obwohl
wir ihm rieten, sein großes, vom Kunstsamm-
ler Franz Hauer erworbenes Bild „Die Auf-
erstehung“, das in Wien noch nicht ausgestellt
||
40.
worden war, zu entlehnen und einzureichen,
malte er ein neues Bild, das aber im Grunde
nur ein Torso blieb, weil er mit der Kom-
position nicht zu Rande kam und nur die
beiden Hauptfiguren malte. Er fiel durch,
obwohl er, nach meiner Meinung, der genialste
der ausstellenden Künstler war. Den ersten
Preis errang Anton Faistauer für einen weib-
lichen Akt, den zweiten Paris Gütersloh für
eine Madonna. Das Urteil, das nur auf
Grund der eingereichten Bilder gefällt wer-
den konnte, war durchaus gerecht.
Endlich schlug Egon Schieles große Stunde.
Seine Ausstellung in der Secession im März
1918 brachte ihm die langverdiente allge-
meine Anerkennung und damit auch reichen
materiellen Erfolg. Er war der Existenzsor-
gen ledig.
Ich besuchte Schiele kurz nach dem Zusammen-
bruche der Monarchie. Er war schon lange, im
Gegensatze zu mir, der Ansicht gewesen, daß
||
41.
die Entente siegen würde und behielt Recht.
Er sagte mir damals: „Sehen Sie, Herr B.,
was hab‘ ich Ihnen gesagt.“
Etwa Mitte Oktober sah ich Schiele zum letzten-
male. Er zeigte mir eine Reihe neuer Blätter,
darunter farbige Darstellungen von Gruppen
von Zierkrügen. Eines der schönsten dieser
Blätter überließ er mir auf meine schüchterne
Frage zu dem wahren Freundschaftspreise von
50 Kronen – ein Beispiel seiner Güte und
Dankbarkeit. Er bekam damals für ein sol-
ches Blatt 200 bis 300 Kronen. Als ich ihm
gerührt dankte, meinte er begütigend:
„Ich verliere bei Ihrem Blatte nur drei
Nachtmahle.“ Er pflegte nämlich mit seiner
Frau fast täglich im Restaurant Ottakringer-
Bräu am Hietzinger Platze das Abendessen
einzunehmen. Dabei ließen sie sich nichts
abgehen, zahlten aber im Durchschnitte
50 Kronen pro Abend. Damals begann schon
die Inflation.
||
42.
Ich schied von Schiele mit einem Händedrucke.
Wir wußten nicht, daß es der letzte war.
Am Abend des 28. Oktober 1918 erhielt ich
von Schiele ein Telegramm: „Edith Schiele
nicht mehr“. Ich war tief bestürzt, denn ich
wußte nichts von ihrer Erkrankung. Frau Edith
Schiele war nach achttägigem Krankenlager der
Spanischen Grippe erlegen. Mit ihr starb keimend-
des Leben. Am nächsten Nachmittage war ich in
der Wattmanngasse und fand Frau Schiele auf
dem Totenbette. Schiele war nicht anwesend;
man sagte mir, er sei auch erkrankt und
liege in der Wohnung seiner Schwiegermutter,
Hietzinger Hauptstraße Nr 114. Ich wollte ihn am
nächsten Tage besuchen, erkrankte aber in-
zwischen selbst. Am 1. November um 8 Uhr Mor-
gens stand die Schwester von Schieles Schwager
Peschka vor mir und sagte: „Herr Benesch,
der Egon Schiele ist gestorben.“ Mir war, als
stürze der Himmel ein und ich brauchte lange,
bis ich das Ereignis in ganzer Bedeutung
||
43.
erfaßte. Als am 30. Oktober die Leiche der Frau
Edith auf der Fahrt auf den St. Veiter Friedhofe
das Vaterhaus passierte, kämpfte dort ihr Gatte
Egon mit dem Tode. Am 31. Oktober starb er nach
dreitägigem Krankenlager. Sein schwaches Herz
hatte nicht länger standgehalten. Er litt sehr
in diesen Tagen, aber der Tod war sanft und
ruhig. Die linke Hand unter den Kopf gelegt,
schlummerte er hinüber. Er hatte seine Frau
am Tage vor ihrem Tode noch einmal gezeichnet.
Das Bild ist von erschütternder Wirkung. Deut-
lich liegen schon die Schatten des Todes auf
dem jungen Angesichte.
Schiele hatte eine Ahnung von seinem Ende.
Noch vor der Erkrankung seiner Frau sagte
er zu seinem Schwager Peschka: „Mir steht et-
was Großes bevor; ich weiß nur nicht, was
es ist.“
Sonntag den 3. November fand seine Beer-
digung statt. Er wurde, wie seine Gattin, im
Grabe von deren Vater auf dem St. Veiter
||
44.
Friedhofe beigesetzt. Ich konnte wegen meiner
Erkrankung an der Leichenfeier nicht teilnehmen,
wohl aber mein Sohn. Einige Tage später wohnte
ich der Seelenmesse des Verewigten bei.
Damit war unter Egon Schieles Leben
und unsere Freundschaft der Schlußstrich gezogen.
Wenige Jahre später wurden die Leichen
von Egon und Edith Schiele in ein von der
Gemeinde Wien auf demselben Friedhofe ge-
widmetes Ehrengrab umgebettet. Im Jahre
1929 wurde auf Veranlassung der „Gesell-
schaft zur Förderung moderner Kunst“ in
Wien auf diesem Grabe ein vom Bildhauer
Benjamin Ferenczy geschaffenes Grabmal
aufgestellt, dessen Kosten von Schieles Freun-
den und Verehrern bestritten worden waren.
Wien, im November 1943.
Heinrich Benesch.
(Nachtrag nächste Seite.)
||
45.
Nachtrag.
Ehe ich Egon Schiele kennen lernte, hatte ich schon einige
Bilder junger Künstler erworben. Es waren die Ma-
ler Hugo Baar, Otto Barth, Friedrich Beck, Adolf
Groß * und Hans Katzler. Sie waren durchaus tüchtige
Impressionisten und mit Ausnahme Katzlers (der nur
Autodidakt, dennoch aber ein sehr feiner Künstler ist)
Mitglieder der Künstlervereinigung „Jungbund“,
die später im Künstlerbunde „Hagen“ aufging.
Als Schiele mich das erstemal besuchte, und
meine kleine Galerie betrachtete, fragte ich ihn:
„Nun, was sagen Sie zu meinen Bildern?“ Er
erwiderte ruhig und freundlich: „Es sind einige
darunter, die nicht ganz schlecht sind.“ (Der Ton
lag auf dem Worte „ganz“).
Dieser Ausspruch, der mich sehr erheiterte,
denn ich war mir des künstlerischen Wertes der
Bilder wohl bewußt, beweist in erster Linie Schie-
les große Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Er zeigt aber
auch, wie ferne Schiele in seinen künstlerischen Anschau-
*Gustav Jahn
||
46.
ungen jenen Künstlern stand, die nicht vollstän-
dig Neues, Großes brachten. Er wollte gewiß nicht
die Künstler schmähen und beabsichtigte auch nicht,
mir die Bilder mies zu machen – er war nur
ehrlich ohne jeden Rückhalt. Sein vernichtendes Ur-
teil hat mich auch nicht beirrt; die Bilder sind
mir heute so lieb wie damals, als ich sie erwarb.
Trotzdem – mit den Jungen, die was kön-
nen, gehe ich heute noch durch dick und dünn,
denn die Jugend des Herzens habe ich mir
bewahrt.
B.
Anmerkungen
[1] ESDA ID 2367.
Eigentümer*in
Autor*in
Abbildungsnachweis
Albertina, Wien
Verknüpfte Objekte
PURL: https://www.egonschiele.at/2564