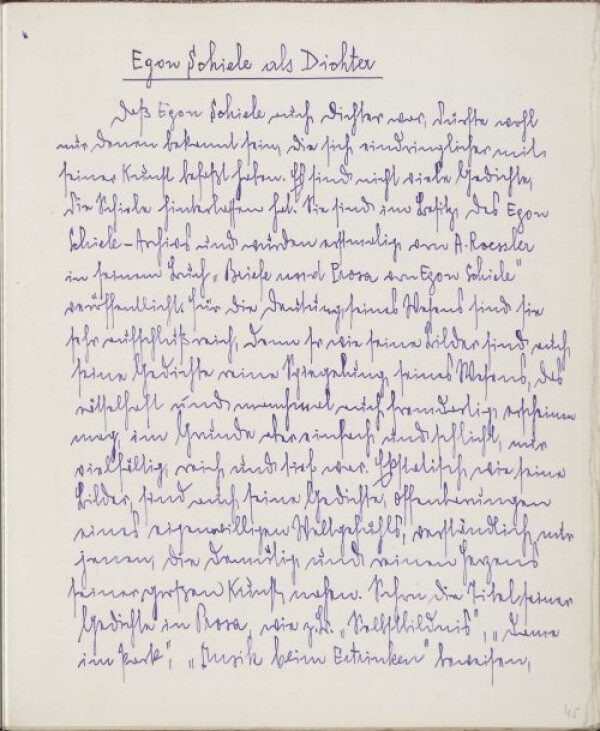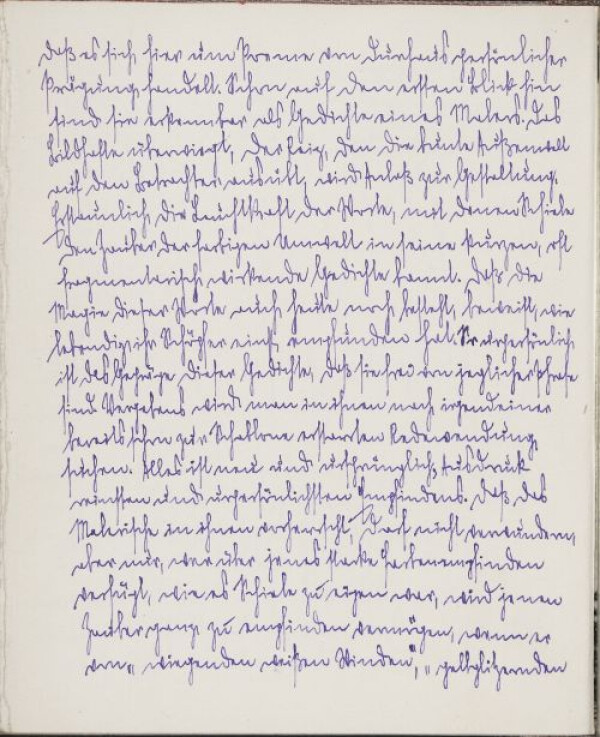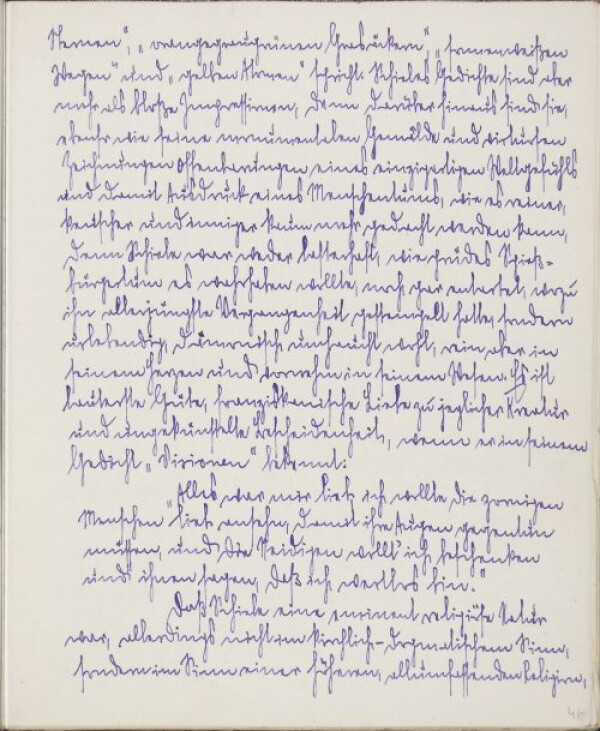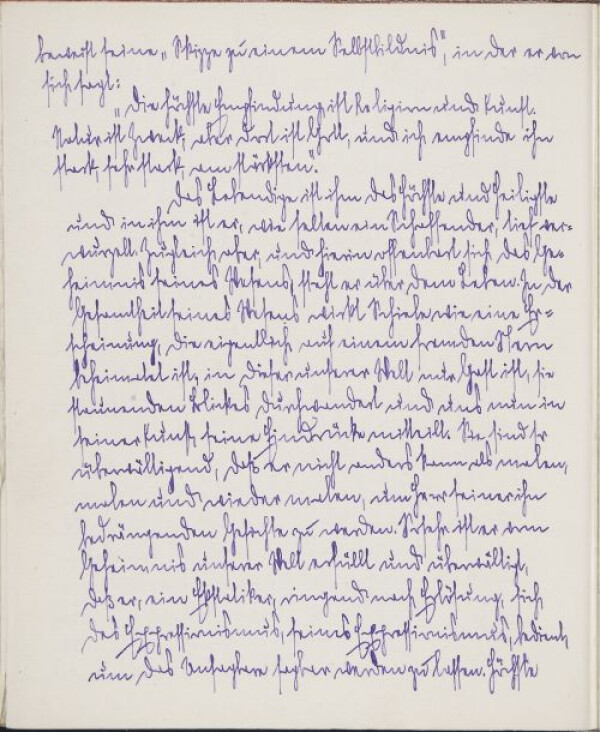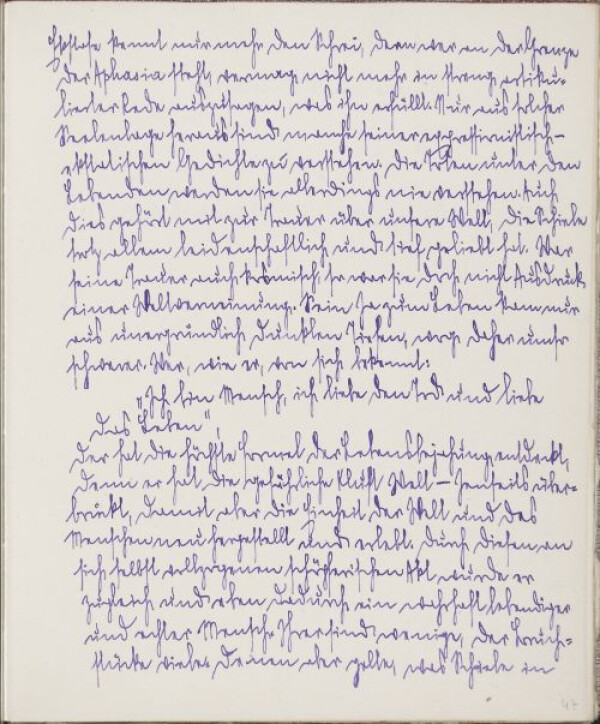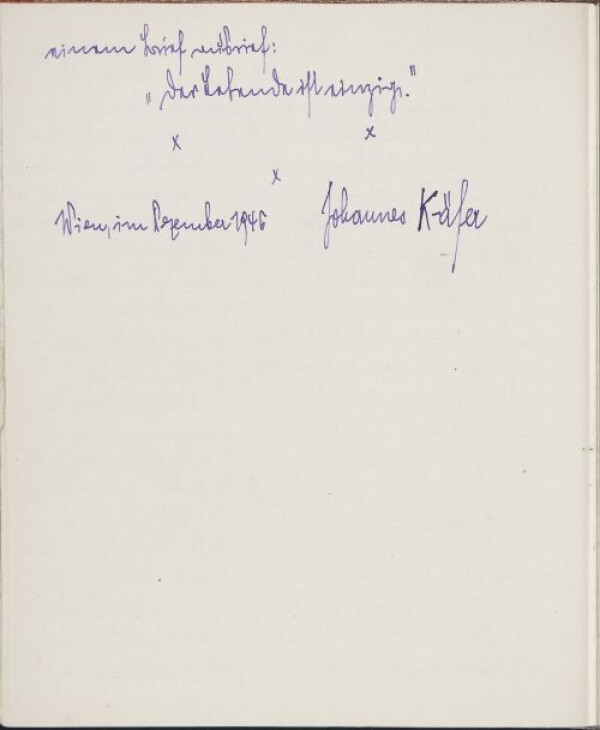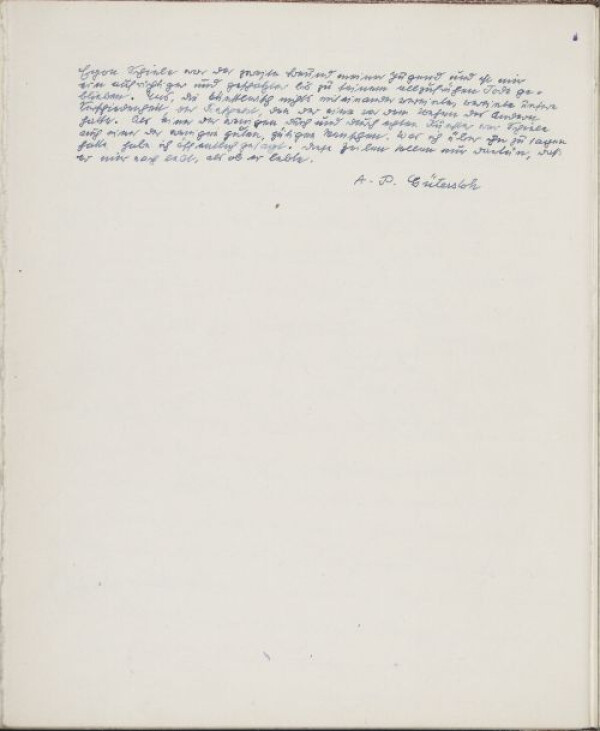Beitrag von Johannes Käfer für das „Erinnerungsbuch Egon Schiele“
Albertina, Wien
ESDA ID
2567
Nebehay 1979
Nicht gelistet/Not listed
Bestandsnachweis
Albertina, Wien, Inv. ESA 508/45–47
Ort
Wien
Datierung
12.1946 (eigenhändig)
Material/Technik
Schwarze Tinte auf Papier
Maße
19 x 15,5 cm (Seite)
Transkription
Egon Schiele als Dichter
Daß Egon Schiele auch Dichter war, dürfte wohl
nur denen bekannt sein, die sich eindringlicher mit
seiner Kunst befaßt haben. Es sind nicht viele Gedichte,
die Schiele hinterlassen hat. Sie sind im Besitz des Egon
Schiele-Archivs und wurden erstmalig von A. [Arthur] Roessler
in seinem Buch „Briefe und Prosa von Egon Schiele"
veröffentlicht. Für die Deutung seines Wesens sind sie
sehr aufschlußreich, denn so wie seine Bilder sind auch
seine Gedichte reine Spiegelung seines Wesens, das
rätselhaft und manchmal auch fremdartig erscheinen
mag, im Grunde aber einfach und schlicht, nur
vielfältig, reich und tief war. Ekstatisch, wie seine
Bilder, sind auch seine Gedichte, Offenbarungen
eines eigenwilligen Wohlgefühls, verständlich nur
jenen, die demütig und reinen Herzens
seiner großen Kunst nahen. Schon die Titel seiner
Gedichte in Prosa, wie z.B. „Selbstbildnis", „Dame
im Park", „Musik beim Ertrinken" beweisen,
||
daß es sich hier um Poeme von durchaus persönlicher
Prägung handelt. Schon auf den ersten Blick hin
sind sie erkennbar als Gedichte eines Malers. Das
Bildhafte überwiegt, der Reiz, den die laute Außenwelt
auf den Betrachter ausübt, wird Anlaß zur Gestaltung.
Erstaunlich die Leuchtkraft der Worte, mit denen Schiele
den Zauber der farbigen Umwelt in seine kurzen, oft
fragmentarisch wirkende Gedichte bannt. Daß die
Magie dieser Worte auch heute noch besteht, beweist, wie
lebendig ihr Schöpfer einst empfunden hat. So urpersönlich
ist das Gepräge dieser Gedichte, daß sie frei von jeglicher Phrase
sind. Vergebens wird man in ihnen nach irgendeiner
bereits schon zur Schablone erstarrten Redewendung
suchen. Alles ist neu und ursprünglich, Ausdruck
reinsten und urpersönlichsten Empfindens. Daß das
Malerische in ihnen vorherrscht, darf nicht verwundern,
aber nur, wer über jenes starke Farbenempfinden
verfügt, wie es Schiele zu eigen war, wird jenen
Zauber ganz zu empfinden vermögen, wenn er
von „wiegenden weißen Winden", „gelbglitzernden
||
Sternen" [1], „orangegraugrünen Grasackern" [2], „sonnenweißen
Wegen" [3] und „gelben Atomen" [4] spricht. Schieles Gedichte sind aber
mehr als bloße Impressionen, denn darüber hinaus sind sie,
ebenso wie seine monumentalen Gemälde und virtuosen
Zeichnungen Offenbarungen eines einzigartigen Weltgefühls
und damit Ausdruck eines Menschentums, wie es reiner,
keuscher und inniger kaum mehr gedacht werden kann,
denn Schiele war weder lasterhaft, wie prüdes Spieß-
bürgertum es wahrhaben wollte, noch gar entartet, wozu
ihn allerjüngste Vergangenheit gestempelt hatte, sondern
urlebendig, dämonisch umhaucht wohl, rein aber in
seinem Herzen und vornehin in seinem Wesen. Es ist
lauterste Güte, franziskanische Liebe zu jeglicher Kreatur
und ungekünstelte Bescheidenheit, wenn er in seinem
Gedicht „Visionen" [5] bekennt:
„Alles war mir lieb, ich wollte die zornigen
Menschen lieb ansehn, damit ihm Augen gegentun
müssen, und die Neidigen wollt’ ich beschenken
und ihnen sagen, daß ich wertlos bin."
Daß Schiele eine eminent religiöse Natur
war, allerdings nicht im kirchlich-dogmatischen Sinn,
sondern im Sinn einer höheren, allumfassenden Religion,
||
beweist seine „Skizze zu einem Selbstbildnis" [6], in der er von
sich sagt:
„Die höchste Empfindung ist Religion und Kunst.
Natur ist Zweck; aber dort ist Gott, und ich empfinde ihn
stark, sehr stark, am stärksten."
Das Lebendige ist ihm das Höchste und Heiligste
und in ihm ist er, wie selten ein Schaffender, tief ver-
wurzelt. Zugleich aber, und hierin offenbart sich das Ge-
heimnis seines Wesens, steht er über dem Leben. In der
Gesamtheit seines Wesens wirkt Schiele wie eine Er-
scheinung, die eigentlich auf einem fremden Stern
beheimatet ist, in dieser unserer Welt nur Gott ist, sie
staunenden Blickes durchwandert und uns nun in
seiner Kunst seine Eindrücke mitteilt. Sie sind so
überwältigend, daß er nicht anders kann als malen,
malen und wieder malen, um Herr seiner ihn
bedrängenden Gefühle zu werden. So sehr ist er vom
Geheimnis unserer Welt erfüllt und überwältigt,
daß er, ein Ekstatiker, ringend nach Erlösung, sich
des Expressionismus, seines Expressionismus, bedient,
um das Unsagbare sagbar werden zu lassen. Höchste
||
Ekstase kennt nur mehr den Schrei, denn wer an der Grenze
der Aphasia steht, vermag nicht mehr in streng artiku-
lierter Rede auszusagen, was ihn erfüllt. Nur aus solcher
Seelenlage heraus sind manche seiner expressionistisch-
ekstatischen Gedichte zu verstehen. Die Toten unter den
Lebenden werden sie allerdings nie verstehen. Auch
diese gehört mit zur Trauer über unsere Welt, die Schiele
trotz allem leidenschaftlich und tief geliebt hat. War
seine Trauer auch kronisch [chronisch], so war sie doch nicht Ausdruck
einer Weltverneinung. Sein Ja zum Leben kam nur
aus unergründlich dunklen Tiefen, wog daher umso
schwerer. Wer, wie er, von sich bekennt:
„Ich bin Mensch, ich liebe den Tod und ich liebe
das Leben",
der hat die höchste Formel der Lebensbejahung entdeckt,
denn er hat die gefährliche Kluft Welt – Jenseits über-
brückt, damit aber die Einheit der Welt und des
Menschen neu hergestellt und erlebt. Durch diesen an
sich selbst vollzogenen schöpferischen Akt wurde er
zugleich und eben dadurch ein wahrhaft lebendiger
und echter Mensch. Ihrer sind wenige, der Bruch-
stücke viele. Denen aber gelte, was Schiele in
||
einem Brief [7] ausrief:
„Der Lebende ist einzig."
x x x
Wien, im Dezember 1946 Johannes Käfer
Daß Egon Schiele auch Dichter war, dürfte wohl
nur denen bekannt sein, die sich eindringlicher mit
seiner Kunst befaßt haben. Es sind nicht viele Gedichte,
die Schiele hinterlassen hat. Sie sind im Besitz des Egon
Schiele-Archivs und wurden erstmalig von A. [Arthur] Roessler
in seinem Buch „Briefe und Prosa von Egon Schiele"
veröffentlicht. Für die Deutung seines Wesens sind sie
sehr aufschlußreich, denn so wie seine Bilder sind auch
seine Gedichte reine Spiegelung seines Wesens, das
rätselhaft und manchmal auch fremdartig erscheinen
mag, im Grunde aber einfach und schlicht, nur
vielfältig, reich und tief war. Ekstatisch, wie seine
Bilder, sind auch seine Gedichte, Offenbarungen
eines eigenwilligen Wohlgefühls, verständlich nur
jenen, die demütig und reinen Herzens
seiner großen Kunst nahen. Schon die Titel seiner
Gedichte in Prosa, wie z.B. „Selbstbildnis", „Dame
im Park", „Musik beim Ertrinken" beweisen,
||
daß es sich hier um Poeme von durchaus persönlicher
Prägung handelt. Schon auf den ersten Blick hin
sind sie erkennbar als Gedichte eines Malers. Das
Bildhafte überwiegt, der Reiz, den die laute Außenwelt
auf den Betrachter ausübt, wird Anlaß zur Gestaltung.
Erstaunlich die Leuchtkraft der Worte, mit denen Schiele
den Zauber der farbigen Umwelt in seine kurzen, oft
fragmentarisch wirkende Gedichte bannt. Daß die
Magie dieser Worte auch heute noch besteht, beweist, wie
lebendig ihr Schöpfer einst empfunden hat. So urpersönlich
ist das Gepräge dieser Gedichte, daß sie frei von jeglicher Phrase
sind. Vergebens wird man in ihnen nach irgendeiner
bereits schon zur Schablone erstarrten Redewendung
suchen. Alles ist neu und ursprünglich, Ausdruck
reinsten und urpersönlichsten Empfindens. Daß das
Malerische in ihnen vorherrscht, darf nicht verwundern,
aber nur, wer über jenes starke Farbenempfinden
verfügt, wie es Schiele zu eigen war, wird jenen
Zauber ganz zu empfinden vermögen, wenn er
von „wiegenden weißen Winden", „gelbglitzernden
||
Sternen" [1], „orangegraugrünen Grasackern" [2], „sonnenweißen
Wegen" [3] und „gelben Atomen" [4] spricht. Schieles Gedichte sind aber
mehr als bloße Impressionen, denn darüber hinaus sind sie,
ebenso wie seine monumentalen Gemälde und virtuosen
Zeichnungen Offenbarungen eines einzigartigen Weltgefühls
und damit Ausdruck eines Menschentums, wie es reiner,
keuscher und inniger kaum mehr gedacht werden kann,
denn Schiele war weder lasterhaft, wie prüdes Spieß-
bürgertum es wahrhaben wollte, noch gar entartet, wozu
ihn allerjüngste Vergangenheit gestempelt hatte, sondern
urlebendig, dämonisch umhaucht wohl, rein aber in
seinem Herzen und vornehin in seinem Wesen. Es ist
lauterste Güte, franziskanische Liebe zu jeglicher Kreatur
und ungekünstelte Bescheidenheit, wenn er in seinem
Gedicht „Visionen" [5] bekennt:
„Alles war mir lieb, ich wollte die zornigen
Menschen lieb ansehn, damit ihm Augen gegentun
müssen, und die Neidigen wollt’ ich beschenken
und ihnen sagen, daß ich wertlos bin."
Daß Schiele eine eminent religiöse Natur
war, allerdings nicht im kirchlich-dogmatischen Sinn,
sondern im Sinn einer höheren, allumfassenden Religion,
||
beweist seine „Skizze zu einem Selbstbildnis" [6], in der er von
sich sagt:
„Die höchste Empfindung ist Religion und Kunst.
Natur ist Zweck; aber dort ist Gott, und ich empfinde ihn
stark, sehr stark, am stärksten."
Das Lebendige ist ihm das Höchste und Heiligste
und in ihm ist er, wie selten ein Schaffender, tief ver-
wurzelt. Zugleich aber, und hierin offenbart sich das Ge-
heimnis seines Wesens, steht er über dem Leben. In der
Gesamtheit seines Wesens wirkt Schiele wie eine Er-
scheinung, die eigentlich auf einem fremden Stern
beheimatet ist, in dieser unserer Welt nur Gott ist, sie
staunenden Blickes durchwandert und uns nun in
seiner Kunst seine Eindrücke mitteilt. Sie sind so
überwältigend, daß er nicht anders kann als malen,
malen und wieder malen, um Herr seiner ihn
bedrängenden Gefühle zu werden. So sehr ist er vom
Geheimnis unserer Welt erfüllt und überwältigt,
daß er, ein Ekstatiker, ringend nach Erlösung, sich
des Expressionismus, seines Expressionismus, bedient,
um das Unsagbare sagbar werden zu lassen. Höchste
||
Ekstase kennt nur mehr den Schrei, denn wer an der Grenze
der Aphasia steht, vermag nicht mehr in streng artiku-
lierter Rede auszusagen, was ihn erfüllt. Nur aus solcher
Seelenlage heraus sind manche seiner expressionistisch-
ekstatischen Gedichte zu verstehen. Die Toten unter den
Lebenden werden sie allerdings nie verstehen. Auch
diese gehört mit zur Trauer über unsere Welt, die Schiele
trotz allem leidenschaftlich und tief geliebt hat. War
seine Trauer auch kronisch [chronisch], so war sie doch nicht Ausdruck
einer Weltverneinung. Sein Ja zum Leben kam nur
aus unergründlich dunklen Tiefen, wog daher umso
schwerer. Wer, wie er, von sich bekennt:
„Ich bin Mensch, ich liebe den Tod und ich liebe
das Leben",
der hat die höchste Formel der Lebensbejahung entdeckt,
denn er hat die gefährliche Kluft Welt – Jenseits über-
brückt, damit aber die Einheit der Welt und des
Menschen neu hergestellt und erlebt. Durch diesen an
sich selbst vollzogenen schöpferischen Akt wurde er
zugleich und eben dadurch ein wahrhaft lebendiger
und echter Mensch. Ihrer sind wenige, der Bruch-
stücke viele. Denen aber gelte, was Schiele in
||
einem Brief [7] ausrief:
„Der Lebende ist einzig."
x x x
Wien, im Dezember 1946 Johannes Käfer
Anmerkungen
[1] ID 295
[2] ID 140
[3] ID 2241
[4] ID 296
[5] ID 1923
[6] ID 1933
[7] ID 300
[2] ID 140
[3] ID 2241
[4] ID 296
[5] ID 1923
[6] ID 1933
[7] ID 300
Eigentümer*in
Autor*in
Abbildungsnachweis
Albertina, Wien
Verknüpfte Objekte
PURL: https://www.egonschiele.at/2567